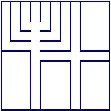ONLINE-EXTRA Nr. 7
© 2005 Copyright bei Autor und Verlag
Nachfolgender Text des evangelischen Theologen Peter von der Osten-Sacken, Leiter des Instituts Kirche und Judentum in Berlin sowie diesjähriger Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille, wurde erstmals publiziert in dem Buch "Lernen auf Zukunft hin. Einsichten des christlich-jüdischen Gesprächs - 25 Jahre Studium in Israel" (siehe Anzeige), und kürzlich wiederabgedruckt in der Zeitschrift "Begegnungen. Zeitschrift für Kirche und Judentum" (Nr. 4, 2004; siehe Anzeige).
COMPASS dankt dem Autor und den Herausgebern von Buch und Zeitschrift für die Genehmigung zur Online-Wiedergabe an dieser Stelle!
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 7
So sehe ich, wenn ich an die nächste Generation denke, die Notwendigkeit für ein weitergefaßtes Programm, das weniger festgelegt ist durch unser wechselseitiges Verflochtensein und das hungrig danach ist, den anderen in seiner Ganzheit kennenzulernen. In gewissem Sinne könnte die Gründung des Staates Israel, durch die die jüdische Präsenz zu einer Nation unter Nationen wurde, auf lange Sicht zu dieser ‚Entflechtung’ (disentanglement) kräftig beitragen, so daß wir Christen die Juden in ihrer Ganzheit und Unverwechselbarkeit sehen lernen und nicht nur an unsere Vorgeschichte mit einer bestimmten Kontinuität denken, die im jüdisch-christlichen Dialog positiv bewertet wird. Nur wenn wir unverwechselbar und frei sind in unserem jeweiligen Anderssein, kann die Freundschaft wachsen und sich vertiefen zur Bereicherung der gegenseitigen Beziehungen.2 Der Beitrag Stendahls fiel Mitte der achtziger Jahre in bestimmtem Sinne wie eine reife Frucht vom Baum. In den sechziger und siebziger Jahren hatte man christlicher- und kirchlicherseits im Horizont von NS-Herrschaft und Völkermord an den Juden mit Schrecken das Zerrbild wahrgenommen, das man im Rahmen einer jahrhundertelangen Lehre der Judenverachtung3 vom jüdischen Volk tradiert und eingeprägt hatte. Auf verschiedenen Ebenen hatte man entsprechend sukzessive Anstrengungen unternommen, dieses Bild zu korrigieren, nicht zuletzt mit jüdischer Hilfe. Judentum und Christentum wurden nicht mehr als von ihren Anfängen her unüberbietbare Gegensätze verstanden und dargestellt, vielmehr kam im Gegenzug geradezu unvermeidlich der Frage erhebliches Gewicht zu, was ungeachtet alles Trennenden dennoch gemeinsam war, was vielleicht nur scheinbar trennte und ähnliche Fragen mehr. Man kann diesen Prozess, der hier fraglos bekannt und darum auch nicht näher darzustellen ist, ohne Mühe an den kirchlichen Erklärungen der letzten 25-30 Jahre ablesen. Je länger er andauerte, je mehr Verunsicherung brachte er freilich mit sich. Ihren klassischen Ausdruck hat sie in der regelmäßig zu hörenden Frage gefunden: „Was bleibt dann noch?“ – eben dann, wenn das Verhältnis beider Religionsgemeinschaften weniger dualisierend, weniger absolutistisch oder auch missionarisch begriffen und dargelegt wird. In Übereinstimmung damit ist in den achtziger Jahren die Frage nach der christlichen Identität im christlich-jüdischen Verhältnis sukzessiv in den Vordergrund gerückt. Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit dabei der Aufsatz Stendahls prägend oder, wie angedeutet, die Zeit einfach reif war - in jedem Fall ist die Identitätsfrage seither nicht verstummt. In ihrem Rahmen ist entsprechend in den letzten Jahren auch das Plädoyer Krister Stendahls für eine „Entflechtung“ wieder aufgenommen und thematisiert worden. Bevor ich jedoch darauf zu sprechen komme, ist zumindest eine historische Reminiszenz zu ergänzen. Zu derselben Zeit, als Stendahl seinen Beitrag veröffentlichte, zeigte die Bundeswehr an verschiedenen Orten in Deutschland eine Ausstellung über jüdische Soldaten in der deutschen Wehrmacht im 19. und 20. Jahrhundert. Sie enthielt u.a. den Zeitungsartikel eines jüdischen Feldgeistlichen aus dem Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die bekanntlich durch nachhaltigen Antisemitismus gezeichnet waren. In diesem Artikel gab der Militärrabbiner die unverändert aktuelle Devise aus, das, was das christlich-jüdische oder jüdisch-christliche Verhältnis vorrangig brauche, sei, einander kennen, einander verstehen und einander achten zu lernen. Wer noch das Stendahl-Zitat im Ohr hat, mag über die frappierende Nähe zwischen den Richtungsangaben beider Autoren verblüfft sein. Dennoch gibt es bei näherem Hinsehen einen feinen Unterschied. Stendahl plädiert dafür, die jeweils andere Gemeinschaft in ihrer Ganzheit und Andersheit kennen zu lernen, sie sehen zu lernen und einander in der jeweiligen Andersheit zu achten; der mir namentlich nicht in Erinnerung gebliebene jüdische Feldgeistliche hingegen dringt darauf, einander kennen, verstehen und achten zu lernen. Ohne dass damit ein Schatten auf den hochverdienten Stendahl fallen soll, erscheint es doch als notierenswert, dass dieses kleine Wörtchen „verstehen“ in seinen Ausführungen fehlt – vielleicht im Rahmen eines dezidierten Plädoyers für ein disentanglement kein Zufall. Doch wir kommen auf diese Frage des Verstehens noch einmal zurück. „ENTFLECHTUNG STATT UMARMUNG“ Stendahls Aufruf zu einer „Entflechtung“ im christlich-jüdischen Verhältnis und die nachhaltige Frage nach der christlichen Identität in diesem Verhältnis hängen sachlich fraglos zusammen; sie sind jedoch keineswegs identisch. So hat es, wenn ich nichts übersehen habe, immerhin etwa eine halbe Generation gedauert, bis Stendahls eindringlicher Vorschlag aufgenommen und thematisiert worden ist - so in einem vor geraumer Zeit von Christina Kurth und Peter Schmid herausgegebenen Tagungsband über das christlich-jüdische Gespräch.4 Dort ist er in zwei besonderen Sparten behandelt worden, indirekt in dem Kapitel „Probleme mit der Differenz“5, direkt in dem Schlussteil „Entflechtung statt Umarmung“.6 Ein ebenso konturierter wie herausfordernder Beitrag in diesen beiden Teilen stammt von Aron Ronald Bodenheimer, emeritierter Professor für Psychiatrie an der Universität Tel Aviv, Lehrbeauftragter am Institut für Jüdische Studien in Basel und halachisch der Orthodoxie zugehörig: „Der Alte und das Kind: über jüdische und christliche Identität – und den Mut, sich dazu zu bekennen“.7 Bodenheimers gleich vorweg gebündelte Grundthese lautet: Eine von den auszeichnenden historischen Sendungen des Judentums, dessen Besonderheit auch und fortwirkende Aufgabe, liegt darin, dass es das Alte wie auch das Alter lebendig erhält und von dieser Berufung her das Leben mit der Kraft einer stets sich erneuernden Substanz (quod sub-stat, des darunter Gelegten) durchdringt. Wogegen eine wesentliche Berufung und besondere Eigenart des Christentums bleibend gegeben ist durch die von ihm vollzogene Einführung und weiterwährende Erhaltung des kindlichen Elementes; und dies nicht nur im Kultus [,] sondern in der Kultur wie auch in der Pflege des Zusammenlebens.8 Bodenheimer schließt mit der Richtungsangabe: Damit dieser Gedanke sinnvoll und fruchtbar entwickelt werden kann, ist es vonnöten, dass er wertfrei genommen und ebenso weiter gedacht werde.9 Zur Veranschaulichung seiner Grundthese entwirft er anschließend eine knappe Typologie von Alter und Kindheit. So ordnet er dem Ersteren das Gemessene zu, das Ernste, Gesammelte, Distanz gegenüber allem Aktualistischen, den Einklang mit dem Tod, den Verzicht auf eine soteriologische Deutung von Tod oder Leben (sterben für ... leben für ...). „Alt gedenkt des Uebernommenen, welches es überträgt, damit es hingehen kann.“10 Kindlich hingegen heißt: „Umfassen, ganzheitlich leben, im Bild, in der Melodie, heißt: den Regungen von Gefühlen vor Ableitungen oder Abstraktionen den Vorzug lassen“. Es schließt ein, „unmittelbar, spontan, von daher rücksichtslos“ zu sein sowie eine Neigung zur Märchenwelt mit ihren einfachen Unterscheidungen. „Gesetz ist dem Kind starr und verächtlich, Abstraktion verdächtig“, „Theorie grau“, und wenn es an den Tod denkt, „erlebt es diesen stets nicht einfach als Abgang, sondern als ein Sterben für“.11 Beide Lebensformen sollen nach Bodenheimer, wie er erneut einprägt, nicht evaluierend gegeneinander gehalten werden, weil Kinder „prachtvoll, aufbauend und vernichtend wirken“ können (mit einem Hang zu beiden Tendenzen) und Alte „gütig und auch, oft gleichzeitig, böse, ja grausam sein können“.12 Ob freilich Bodenheimers Konzeption insgesamt so „wertfrei“ ist, wie er es möchte, scheint allein schon angesichts des Tatbestandes zweifelhaft, dass andere Gestalten des Judentums als die orthodoxe in ihr keinen dauerhaften Platz haben, weil sie nicht auf den Transfer des Bleibenden aus sind, sondern sich den Zeitläuften anzugleichen suchen. Die Faszination seiner Ausführungen ist die aller Konzeptionen, die griffig typologisieren und durch Rekurs auf Allgemeinbegriffe scheinbar alles Wesentliche erfassen. Deutlich wird dies an den Beispielen, mit denen er seine Konzeption veranschaulicht. So legt er die Szene „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ (Lk 2,41-52) wie folgt als Beispiel für die kindlich-christliche Überwindung und Missachtung des Alten = Jüdischen aus: „Da steht das Kind der reinen Jungfrau den Schriftgelehrten und Priestern gegenüber – ausschließlich Alten mithin – und macht sie mit ihren alten Lehren verächtlich.“1314 Bei Lukas aber heißt es tatsächlich: Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie [sc. Jesu Eltern] ihn im Tempel, wie er mitten unter [!] den Lehrern saß, ihnen zuhörte [!] und sie fragte [!]. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über seine Einsicht und seine Antworten. (Lk 2,46f). Kein einziges Wort von dem ist hier zu finden, was Bodenheimer in die kleine Erzählung hineingelesen hat, und so scheint die Realität differenzierter und komplizierter zu sein, als es seine Sicht der Dinge zulässt. Erinnern wir uns, dass nach Bodenheimer Mangel an Differenzierung oder der Hang zur Vereinfachung gerade das Kennzeichen der Jugend ist, so ist er im zitierten Zusammenhang selber bemerkenswert jung geblieben ... Der Autor resümiert seine Dialogsicht gegen Ende stichwortartig mit den Sätzen: Zum Dialog bereit sein, aber gemäss [sic] Grundsätzen der Dialektik, das will sagen: an dem Anderen – durch Achtung vor dem Anderen – uns selbst immer neu zu entdecken; ‘Ajin B‘ajin [Auge in Auge]: verschiedenartig, aber gleichwertig.14 Verschiedenartig, aber gleichwertig – das ist ein einladender Wegweiser. Dialog deshalb, um „an dem Anderen ... uns selbst immer neu zu entdecken“ – ohne Frage ein wichtiger Aspekt. Aber ist diese Funktionalisierung des Dialogs die „Entflechtung“, die Stendahl im Sinn gehabt hat und die für uns wegweisend sein sollte? Immerhin spielt auch in den zitierten Sätzen Bodenheimers das Motiv des Verstehens des anderen keine ausdrückliche Rolle, obwohl er das Christentum im Rahmen seiner Selbstentdeckung des Judentums als Alter (im Gegenüber zum Christentum als Kind) partiell zu deuten gesucht hat. In summa: Man muss mit dieser ganz und gar ungeschichtlichen, doch beide Seiten in manchen Teilen treffend charakterisierenden Konzeption heftig ringen, aber sie würde eben auch als Thema einer ganzen christlich-jüdischen Tagung lohnen. Man könnte dann auch fragen, ob der Alte und das Kind in ihrem Verhältnis wesentlich erfasst werden, wenn der eine Teil am anderen vor allem seine eigene Eigenheit wiederentdeckt. „DIE WÜRDE DER DIFFERENZ“ Erholen wir uns einen Augenblick bei einem kleinen Beitrag von Chief Rabbi Jonathan Sacks mit dem schönen Titel „Die Würde der Differenz“, der getragen ist von dem Verständnis, dass – um eine geläufige Wendung zu gebrauchen – die Wahrheit perspektivisch ist.15 „Die wirkliche Bedeutung göttlicher Transzendenz“ besteht nach Sacks darin, dass Gott größer ist als [jedwede] Religion. Dass er lediglich zum Teil durch meinen Glauben verstanden wird, durch jeden Glauben. Er ist mein Gott, aber ist ebenso dein Gott. Er ist auf meiner Seite, aber ebenso auf deiner Seite. Er existiert in meinem Glauben, aber ebenso in deinem ... Inmitten unserer vielfachen Unsicherheiten [sc. des 21. Jh.s] brauchen wir jetzt das Vertrauen und die Großherzigkeit, die unwiderrufliche Würde einer jeden Gemeinschaft anzuerkennen und zu wissen, dass die, die ihrem Glauben die Treue halten, durch den verschiedenen Glauben der anderen nicht bedroht werden, sondern zutiefst bereichert.16 Aber es war dies nur eine Erholungspause, denn vielleicht rührt die Beschreibung dessen, was alle Religionen auf ihre Weise ausmacht, als „Glaube“ bereits aus einem zu großen Einvernehmen her, so wenig ich auch meine Sympathie für Sacks Position verhehlen möchte.
Wenige Jahre nach Beginn des Programms Ein Studienjahr in Israel 1978 hat der Neutestamentler an der Harvard-Universität und spätere schwedische Bischof Krister Stendahl einen Beitrag veröffentlicht: „Die nächste Generation in den christlich-jüdischen Beziehungen“.1 Er hat darin die folgenden unverändert nachdenkenswerten Sätze niedergelegt:
25 Jahre "Studium in Israel"
|
|
Peter von der Osten-Sacken; Rachel M. Herweg; Verena Lenzen; Moshe Zimmermann; Yehoyada Amir; Martin Stöhr; Michael Krupp; Katja Kriener; Dagmar Mensik; Wolfgang Raupach-Rudnick; Michael Welker; Wolfgang Kraus.
DIE EIGENE IDENTITÄT WAHREN Nehmen wir uns deshalb für einen Moment einen etwas größeren Brocken vor. Die christlichen Bemühungen um eine Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses haben, wie eingangs erinnert, zur Frage nach der christlichen Identität in diesen Bemühungen geführt. Man konnte mit Sicherheit erwarten, dass entsprechend nach dem Erscheinen der Erklärung „Dabru Emet“ alsbald die analoge Frage auf jüdischer Seite laut werden würde. Am schärfsten scheint sich John D. Levenson geäußert zu haben. Seinen Beitrag zur Sache17 könnte man ein einziges Plädoyer für ein radikales disentanglement nennen – ohne dass allerdings auch nur andeutungsweise deutlich würde, wie und warum denn nun der jüdisch-christliche Dialog zu führen sei. Im Rahmen seiner Argumentation hat Levenson einen geradezu klassischen Text zur Sicherung jüdischer Identität zitiert, dem so oder so – wie immer man also über seinen Aufsatz denkt – großes Gewicht zukommt und der auch christlicherseits im christlich-jüdischen Dialog alle Beachtung verdient: Da der Heilige, gepriesen sei Er, voraussah [man muss ergänzen: historisch nicht ganz genau voraussah ...], dass die Völker der Welt die Tora übersetzen [!], sie auf Griechisch lesen und sagen würden: ‚Wir sind Israel’, und [dass] von da an die Waagschalen (zwischen Juden und Heiden, die das Recht beanspruchen, Israel zu sein) ausgeglichen sein würden, sagte der Heilige, gepriesen sei Er, zu den Völkern: ‚Ihr sagt, dass ihr meine Kinder seid. [Ich weiß es nicht.] Was ich weiß, ist, dass diejenigen, die mein Geheimnis besitzen – das sind meine Kinder. Und was ist es? Es ist die Mischna (Lehre), die mündlich gegeben worden ist.18 Es ist dies unverkennbar ein Abgrenzungstext, in diesem Sinne auch ein Grenztext, ja, er ist wie ein Zaun um die Tora. Wie ein Wächter soll er Israels Eigenstes bewahren helfen, nachdem ihm das erste Eigene als Identitätsmerkmal genommen ist, die Heilige Schrift. Dieses zweite Eigenste wird in der zitierten hebräischen Überlieferung mit dem griechischen Lehnwort mysterin = mysterion wiedergegeben, obwohl doch das persische Lehnwort ras und das hebräische Wort sod allemal zur Verfügung standen. Die mündliche Lehre Israels ein mysterion – so wie die Tag- und Nachtfahrt im Heiligtum bei der Initiation das Geheimnis des Mysterienkultes der Isis ist und so wie Taufe und Abendmahl die mysteria der Kirche sind.19 Hier, in der mündlichen Lehre, ist das Herz unserer, Israels, Identität, so wie es bei den anderen in ihren Mysterien liegt – so könnte der zitierte Text aus der rabbinischen Tradition wohl gemeint sein, so lässt er sich in jedem Fall in seinem Gewicht verdeutlichen. Auch hier steht die Identitätsfrage auf dem Spiel. Wo ist die eigene Kontur, die verhindert, zu werden wie die Völker ringsum, vor allem auch wie das Volk der Christen, das sich auf dieselbe Bibel beruft und den Würdetitel Israel für sich reklamiert? Wie viel verstehen wir Christinnen und Christen schon von diesem Geheimnis, der mündlichen Lehre, besonders in Gestalt der Halacha, die sie orthodoxem Verständnis nach vor allem meint? Wie viel können wir verstehen von ihrer Kraft, zumal in unserer Tradition immer schon ihre Schwäche als ausgemacht gilt? Darum akzeptieren wir diesen indirekten Halteruf Levensons im Ablauf unserer Überlegungen – allerdings ohne unserem Thema „Das Geheimnis des anderen“ untreu zu werden. Denn diese Wendung ist nicht Levenson entlehnt, auch nicht, wie man vielleicht denken könnte, Emmanuel Levinas, sondern sie entstammt der Feder jenes Mystagogen des Judentums, dessen 125. Geburtstag wir in diesem Jahr gedenken, Martin Buber. „EINANDER IM GEHEIMNIS ANERKENNEN“ Aus der Fülle seiner Veröffentlichungen lassen wir uns damit von dem unerschöpflichen Gespräch Bubers mit Karl-Ludwig Schmidt vom 14. Januar 1933 in Stuttgart leiten.20 In einem vielen der Anwesenden gewiss bekannten Passus hat er dort das Verhältnis von Juden und Christen ebenso hilfreich wie weiterführend umschrieben: Das Juden und Christen Verbindende bei alledem ist ihr gemeinsames Wissen um eine Einzigkeit, und von da aus können wir auch diesem im Tiefsten Trennenden [= der Christusfrage] gegenübertreten; jedes echte Heiligtum kann das Geheimnis eines anderen Heiligtums anerkennen. Das Geheimnis des anderen [!] ist innen in ihm und kann nicht von außen her wahrgenommen werden. Kein Mensch außerhalb von Israel weiß um das Geheimnis Israels. Und kein Mensch außerhalb der Christenheit weiß um das Geheimnis der Christenheit. Aber nicht wissend können sie einander im Geheimnis anerkennen. Wie es möglich ist, daß es die Geheimnisse nebeneinander gibt, das ist Gottes Geheimnis. Wie es möglich ist, daß es eine Welt gibt als Haus, in dem diese Geheimnisse {mitsammen} wohnen, ist Gottes Sache, denn die Welt ist ein Haus Gottes. Nicht indem wir [...] trotz der Verschiedenheit ein Miteinander erschleichen wollen, wohl aber indem wir unter Anerkennung der Grundverschiedenheit in rückhaltlosem Vertrauen einander mitteilen, was wir wissen von der Einheit dieses Hauses [...], dienen wir getrennt und doch miteinander, bis wir einst vereint werden in dem einen gemeinsamen Dienst.21 Ganz auf dieser Linie nennt Buber den Austausch über die Einheit in „rückhaltlosem Vertrauen“ wenig später „einen echten Dialog“, „in dem man sich wohl nicht miteinander verständigt, aber einander versteht, um des einen Seins willen, das die Glaubenswirklichkeiten meinen.“22 Das – nur von innen, nicht von außen wahrnehmbare – „Geheimnis des anderen“ als solches anerkennen, aber dennoch sich im Horizont gemeinsamer Hoffnung austauschen über den transzendenten Grund beider Geheimnisse, sich nicht miteinander verständigen, aber dennoch einander verstehen – in diesen Leitsätzen ist eine bis in die Tiefe reichende Grundverschiedenheit allemal vorausgesetzt, so dass gar keine Entflechtung vonnöten ist, und doch wird an der Möglichkeit oder mehr noch an dem Postulat des Verstehens ausdrücklich festgehalten. Würden wir dieses Ziel eines – zumindest fragmentarischen – Verstehens nicht mehr groß schreiben, dann würden wir, so will es scheinen, vielleicht zu einem respektvollen und durchaus respektablen Nebeneinander kommen; aber es dürfte wohl auch der gesamte Strom oder – etwas plastischer – der gesamte „Saft“ aus den Leitungen heraus sein, die beide Seiten verbinden. Es könnte im Gefolge dessen auch eine Chance vergeben werden, das christlich-jüdische Verhältnis in einem durch Verstehen qualifizierten Sinne zu erneuern. Zumindest ansatzweise möchte ich dies in loser Anknüpfung an das Gespräch zwischen Buber und Schmidt verdeutlichen, zugleich in Fortführung von unlängst an anderem Ort niedergelegten knappen Andeutungen zu diesem Thema.23 Lässt sich der Geist oder die Kraft Gottes auf einen jeden – Juden oder Heiden, Mann oder Frau, Knecht oder Magd – nieder allein nach dem Tun, das er tut, wie Martin Buber in jenem Zwiegespräch mit einem Wort der jüdischen Tradition sagt?24 So dass der über den unaufhebbaren Unterschieden wehende Geist allein im tathaft gelebten Augenblick „Bürgschaft der Einheit für das Zusammenleben auch von Christen und Juden gibt“?25 Oder lässt sich, wie Paulus verkündet und gelehrt hat, der Geist oder die Kraft Gottes auf einen jeden nieder, der sich glaubend dem Wort Gottes im Evangelium öffnet? So dass durch Evangelium, Geist und Glaube „alle volkhaften, sozialen und geschlechtlichen Unterschiede ihr Eigengewicht verloren haben“ und in der Kirche an die zweite Stelle rücken?26 TUN UND GLAUBEN In diesem Gegenüber meldet sich unzweideutig das uralte Gegeneinander von Gesetz und Evangelium, von Glaube und Werken, von glauben und tun, von Werkgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit, wie es seinen Niederschlag vor allem in Gal 3, Röm 3-4 und in Röm 9,30-10,13 gefunden hat, hier schwerlich zufällig im Zentrum von Röm 9-11. Alt- und Neutestamentler, Vertreter anderer Disziplinen und engagierte Praktiker hierzulande und in Übersee haben sich in den letzten Jahrzehnten bemüht, verkrustete, destruktive Sichtweisen dieser Antithesen zu korrigieren, und das Gesetz als Größe sehen gelehrt, die bereits im Tenach oder Alten Testament immer schon im Rahmen des Bundes gegeben ist, Wegweisung nach der Befreiung durch den Exodus und im Bund. Von allen diesen Korrekturen ist manches vielleicht im Detail, nichts jedoch im Prinzip zurückzunehmen. Ebenso wenig ist etwa im christlichen Bereich die Rechtfertigung durch Werke des Gesetzes zu proklamieren, ob sie nun ritueller oder ethischer Art sind – das hieße nicht zuletzt die Tür zuschlagen, die Paulus zu den Völkern hin aufgestoßen und aufgehalten hat. Trotzdem bleibt die Frage: Was heißt das, was Mose geschrieben hat: „Der Mensch, der sie [die Gesetze oder Gebote Gottes] tut, wird durch sie leben“ (Lev 18,5; vgl. Röm 10,5)? Was heißt dies dort, wo ein solcher Satz als heller Klang wahrgenommen wird; wenn also nicht Gesetz und Tod, sondern Gesetz und Leben zusammengeschaut und als unverbrüchliche Einheit gewusst werden und dies, obwohl die Treue zum Gesetz unendlich oft mit dem Tode bezahlt worden ist? Andeutungsweise begreifen lassen sich diese Zusammenhänge schwerlich anders als so, dass das Gesetz – für einen Außenstehenden allenfalls erahnbar – Medium der Gotteserfahrung, der Nähe und Zuwendung Gottes ist. Erstaunlicherweise ist dies leichter zu umschreiben, wenn man den – bei Buber ganz ausgeklammerten – Bereich des sogenannten Ritualgesetzes mit einbezieht. Denn dieser gesamte Bereich fällt einerseits ganz in die Kategorie des Tuns, der ma‘ase ha-tora, also der Taten des Gesetzes, und er ist andererseits – anders als vielleicht der von Bubers Tun erfasste Bereich – nicht ablösbar von der Größe „Wort“. Aus einer Kette von hier anführbaren Worten – Segensworten an die Adresse Gottes – mag hier der Gebetsspruch stehen, der die Ausübung eines jeden rituellen Gebotes begleitet: „Gesegnet seist du, HERR, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Gebote und uns die Weisung erteilt hat, [das und das zu tun].“ Hier ist ein Einzelner mit seiner Gemeinschaft für Gott ausgegrenzt und mit Beschlag belegt (geheiligt) durch die Gebote, die nun je und dann die Zeit gestalten sollen, weil die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinschaft durch diese Gebote unlöslich mitkonstituiert ist und durch sie gelebt wird. Man ‚muss’ das nicht tun, was hier jeweils geboten wird, sondern man tut es, um die gestiftete Beziehung zu erhalten oder auch um des Lebens willen, das mit der Tora in Israel eingepflanzt ist, wie es im sogenannten Tora-Segen heißt. Wenn man das, was damit tastend umschrieben ist, mit dem ganzen Herzen, der ganzen Seele und dem ganzen Vermögen (Dtn 6,5) lebt, dann muss Einschneidendes geschehen, damit man das vertraute, das die eigene Existenz tragende, Terrain verlässt. So war es bei Paulus. Martin Buber hat den Glaubensbegriff des Apostels unter Rückgriff auf den gerade berührten Zusammenhang Röm 9,30-10,13 in krasser Antithese zum Judentum gedeutet.27 Während das Äquivalent emuna hier Vertrauen/Treue bedeute, gehe es dem Apostel vor allem darum, dass bestimmte verkündigte oder im Bekenntnis ausgesprochene Sachverhalte geglaubt, d.h. für wahr gehalten würden. Dies ist jedoch – im Übrigen wohl nach beiden Seiten hin – eine Verzeichnung der Begriffs- und Sachlage, da auch Paulus Glaube/glauben (pistis, pisteuein) zu einem nennenswerten Teil durchaus im Sinne des hebräischen emuna (Vertrauen) versteht. Noch kennzeichnender ist jedoch ein Aspekt, den man am ehesten die paulinische Binnenseite des Begriffs nennen könnte. Glaube/glauben ist für Paulus im eminenten Sinne ein apokalyptischer, ein in diesem Sinne dynamischer Begriff – der Hinweis auf die qualifiziert zu verstehende paulinische Rede von der Offenbarung des Glaubens und von seinem Kommen (Gal 3,24f) mag als Verdeutlichung genügen.28 Glaube/glauben bezeichnet deshalb eine Lebensbewegung, durch die man sich mitreißen lässt in die neue Zeit, die man durch die Gestalt Jesu Christi eröffnet, konturiert und geprägt sieht. Der Glaube an Jesus Christus bzw. an Gott als den, der ihn von den Toten erweckt hat, ist nach Paulus in diesem Sinne dynamisch gelebtes endzeitliches Gottesverhältnis in der Zeit. Die ganze pneumatisch umgetriebene Existenz des Apostels mit ihren unglaublichen Energieleistungen ist Vollzug dieses pisteuein, ist wortgeleitete Hingabe an einen letzten Auftrag am Rande der Zeit zugunsten der Völker und damit auch – so die Auffassung des Apostels – zugunsten Israels. Hier muss es charismatisch- enthusiastisch zugehen, und so bekommt ein klein wenig Bodenheimer Recht mit seiner Charakteristik des Christentums; aber hier muss es nach demselben Paulus zugleich mit theologischer Vernunft zugehen, und so bekommt Bodenheimer zugleich ein klein wenig Unrecht. Paulus – der Alte oder das Kind? Das wäre auf jeden Fall ein sehr dialektisches Thema. Man könnte vor allem die Ausführungen zum Tun auf der einen Seite und zum Glauben auf der anderen weiter entfalten, es mag jedoch das Resümee genügen: Das Gegenüber von poiein (tun) und pisteuein (glauben) trifft, recht verstanden, durchaus Wesentliches der christlich-jüdischen Differenz. Entscheidend freilich ist es, möglichst nahe an die Sache heranzukommen und dadurch jede vordergründige Polemik zu vermeiden. Weil es sich um antithetische Zusammenhänge handelt, darum ist hier nicht Entflechtung das Zauberwort, sondern intensiviertes Verstehen, um zu begreifen, wie es hier und da – um Bubers Wort aufzunehmen – „um das eine Sein“ geht, „das die beiden Glaubenswirklichkeiten meinen“. Und dies müsste wohl auch eine zentrale Zielsetzung von „Studium in Israel“ weiterhin bleiben, sein oder werden, je nach dem, wie von Mal zu Mal die Akzente fallen. Martin Buber hat sich bei der Benennung des Gemeinsamen auf die Vergangenheit und die Zukunft verlegt – in Übereinstimmung mit der einmal in anderem Zusammenhang von ihm getroffenen Feststellung, Juden und Christen hätten ein Buch und eine Hoffnung gemeinsam. Das Gewicht dieser beiden Größen lässt sich durch die Feststellung Dietrich Ritschls verdeutlichen, nur wer Erinnerungen und Hoffnungen teile, gehöre wirklich zusammen.29 TENACH UND ALTES TESTAMENT Was nun das Buch, den Tenach oder das Alte Testament angeht, so kann man es seit der Aufklärung und dort, wo diese rezipiert wird, als geradezu klassisches Objekt einer christlich-jüdischen „Umarmung“ bezeichnen: Die Entscheidung für eine konsequent historische Auslegung des Buches ist prinzipiell ein Plädoyer für einen einfachen Schriftsinn, der im Idealfall beide Seiten – Juden und Christen – eint. Demgegenüber ist es diese Stelle, an der ich selber – unter dem Vorzeichen der bleibenden Verbundenheit durch das gemeinsame Buch - für ein partielles disentanglement und damit für eine jüdische und eine christliche Auslegung des Tenach oder Alten Testamentes plädieren möchte. Im Grunde ist dies nur eine Konsequenz aus dem bisher verfolgten Ansatz, nämlich „tun“ und „glauben“, wie wir sie erörtert haben, nicht als einander ausschließende Verhaltensweisen zu verstehen, sondern sie in ihrer eigenen Akzentuierung zu begreifen. Das heißt, Juden und Christen haben ein Buch gemeinsam, aber die dadurch gegebene Einheit liegt gewissermaßen noch hinter diesem Buch. Sie hat ihren Grund in dem verheißenden, Juden und Christen, Israel und die Völker mit seiner Verheißung bis ans Ende der Tage umschließenden Gott. In dem Augenblick bereits, in dem die Kunde von der Zuwendung Gottes literarisch fixiert und bedacht oder ausgelegt wird, tritt geradezu postwendend jener Prozess ein, mit dem die Rabbinen die zwei Dekalogversionen in Ex 20 und Dtn 5 erklärt haben: „Eins (ein Wort) hat Gott geredet, zwei Dinge sind’s, die ich gehört“ (Ps 62,12).
BEGEGNUNGEN - Zeitschrift für Kirche und Judentum
|
|
EIN MEHRFACHER SCHRIFTSINN Ich möchte deshalb dezidiert für die Konzeption eines mehrfachen Schriftsinnes sprechen, neben dem literarisch-historischen (1), auf den sich jüdische und christliche Wissenschaftler im Prinzip leicht einigen können, für einen jüdischen (2) und einen christlichen Schriftsinn (3), die man beide als Ausdruck für den Reichtum der Schrift und für die Relativität unseres Verstehens ansehen sollte und denen man dort, wo sie ins Gespräch gebracht werden, die Kategorie eines je und dann sich zeigenden dialogischen Schriftsinnes (4) zuordnen könnte. Die Relativität meint dabei in erster Linie nicht unsere Begrenztheit, sondern das Beziehungsgefüge unseres Verstehens. Um dies an einem einfachen Beispiel zu veranschaulichen: Es gibt zwei schöne, Juden und Christen einende und trennende, Rufe, auf der einen Seite: am Jisrael chai, „Das Volk Israel lebt!“ – Gott sei Dank, nach allem, was geschehen ist. Auf der anderen Seite – es klingt vielleicht ein bisschen evangelikal, ist aber trotzdem evangelisch und zentral – Jeesous zä, „Jesus lebt!“ und von ihm her dann auch die Kirche. Wenn man diese zentralen Zusammenhänge auf jüdischer und auf christlicher Seite ernst nimmt, dann lässt sich das Verstehen der Schrift gar nicht von ihnen lösen. Diejenigen, die zögern, diesen Überlegungen über einen mehrfachen Schriftsinn gedanklich zu folgen (obwohl sie ihn selber vermutlich schon immer praktizieren), mögen sich nur eine einzige Frage stellen: Ist es vorstellbar, dass man Jes 53 in einem christlichen Existenzhorizont jemals ohne Rekurs auf Jesus von Nazaret auslegen könnte? Er erschließt uns den Gott Israels und Schöpfer der Welt, und er schließt uns mit dem Volk Israel zusammen – wie sollte es dann theologisch unangemessen sein, wenn wir die Schrift christologisch orientiert auslegen, solange jener Ruf bleibt und in einem qualifizierten Sinne gehört wird: am Jisrael chai? Der je eigene Zugang zur Schrift muss dabei dann, wenn er nicht unter dem Vorzeichen steht: entweder so oder so, Juden und Christen in ihrem Verhältnis zur Bibel keineswegs auseinander treiben. Vielmehr hat er dort, wo man sich ein Stück weit füreinander öffnet, die Chance, für beide Seiten bereichernd zu wirken. Diesem – bereits von dem zitierten Stendahl betonten – Stichwort der wechselseitigen Bereicherung (ohne Identitätsverlust) kommt mit Recht zunehmendes Gewicht zu. Die Frage zumal nach einer spezifisch christlichen Interpretation der Hebräischen Bibel wird freilich ohnehin in den nächsten Jahren verstärkt auf der Tagesordnung stehen, und so mag es mit diesen Überlegungen sein Bewenden haben.3031 Auszunehmen ist davon allerdings eine zumindest knappe Erwägung der Frage, ob sich nicht auch dem alten vierfachen Schriftsinn aus Alter Kirche und Mittelalter im Rahmen christlicher Interpretation der Schrift etwas – behutsam gesagt – Schönes oder Konstruktives abgewinnen lassen könnte. Vielleicht ist dies weniger der Fall, wenn man sich an den etwas steif klingenden vier lateinischen Begriffen orientiert: sensus litteralis (wörtlicher, geschichtlicher Sinn) - allegoria (dogmatischer Sinn) - tropologia (ethischer Sinn) - anagoge (zukunftsbezogener Sinn).31 Lässt man sich jedoch von diesem Begriffsgeschwader nicht abschrecken, sondern inspiziert es noch einmal neu, dann sind die vier sensus zwanglos für das Verständnis offen: Jede Schriftstelle ist außer auf ihren einfachen, unmittelbaren Sinn (sensus litteralis) auf die Frage ansprechbar, was sie zur Trias „Glaube (vgl. allegoria), Liebe (vgl. tropologia), Hoffnung (vgl. anagoge)“ beiträgt als dem, was nach Paulus Bestand hat (1Kor 13,13).32 Es ließe sich damit das christliche Verständnis der Bibel in der oben aufgestellten Viererreihe: literarisch-historisches (1) – jüdisches (2) – christliches (3) und – dialogisches Verständnis der Schrift (4) aufs Leichteste durch eben jene Trias „Glaube, Liebe, Hoffnung“ spezifizieren. Eine unverkrampfte Erprobung scheint dieser hermeneutische Schlüssel in jedem Fall wert. Erst ein Versuch, ihn zu handhaben, dürfte erkennen lassen, inwieweit dadurch auch jüdische und christliche Schriftauslegung in ihrem Verhältnis zueinander bereichert zu werden vermögen. In keinem Fall wird es jedoch darum gehen können, beide Weisen der Schriftauslegung – jüdische und christliche – unter ein Joch zu zwingen. Dies ist selbstevident in der Perspektive des Glaubens, es gilt jedoch auch für die der Hoffnung als der zweiten Juden und Christen nach Buber gemeinsamen Größe. Die in ihr gegebene Einheit liegt noch hinter dem, was an Hoffnungsaussagen auf der einen wie der anderen Seite greifbar wird. Dies schließt ein, dass jeder Versuch, die erhoffte Einheit geschichtlich – etwa durch Missionierung – zu verwirklichen, Vorletztes und Letztes verwechselt und in menschliche Hände zu nehmen sucht, was doch in die Domäne Gottes gehört. „AUSLAUFMODELL ODER ZUKUNFTSAUFGABE?“ Greifen wir zum Schluss den Untertitel des Vortrags – „Versuch einer Orientierung im christlich-jüdischen Verhältnis“ – direkter und praktischer auf. Manche mögen den Leitartikel kennen, den Berndt Schaller, evangelisches Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, am 13. März 2003 in der „Jüdischen Allgemeinen“ veröffentlicht hat: „Auslaufmodell oder Zukunftsaufgabe? Zur Woche der Brüderlichkeit: Der christlich-jüdische Dialog auf dem Prüfstand“. Da Schaller die Landschaft wenn auch mit wenigen Strichen, so doch treffend skizziert hat, macht es mir dieser Hinweis auf seinen Beitrag leichter, mich exemplarisch auf drei Zusammenhänge zu beschränken. (1) So treffend der von ihm für den christlich-jüdischen Dialog gewählte Begriff „Auslaufmodell“ als Problemanzeige für manche Bereiche auch ist – für den in dem ganzen Zusammenhang zentralen Bereich der Theologischen Fakultäten trifft er schlechterdings nicht zu. Denn der christlich-jüdische Dialog bzw. – vorsichtiger gesagt – das Thema einer qualifizierten Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses ist an den Fakultäten schlicht und einfach nie ein gängiges Modell gewesen, so dass es zum Auslaufmodell hätte werden können. Wenn man heute von jüdischer Seite gefragt würde, was sich denn nach all den wichtigen Erklärungen und gewichtigen Worten real im Theologiestudium nachweislich der Studien- und Prüfungsordnungen geändert habe, dann müsste man in den meisten Fällen antworten: Die Studierenden haben zwei Pflichtstunden nachzuweisen, in denen sie sich über eine der Weltreligionen zu orientieren haben, und hier kann dann auch das Judentum gewählt werden. Man kann die ganze Erbärmlichkeit der Situation nicht treffender als durch dieses Beispiel verdeutlichen, und auch an dieser Stelle gebührt dem Bad Segeberger Pfarrer em. Friedrich Gleiss alle Anerkennung, dass er dies vor rund zehn Jahren durchgeprüft und öffentlich gemacht hat.33 Ich schlage mir in diesem Zusammenhang auch an die eigene Brust – vielleicht hätte man noch öfter auf der Matte stehen und bitten oder betteln müssen und sich mit den Ausflüchten nicht abfinden dürfen, das Thema käme ohnehin in jedem Fach vor (ein besonders überzeugendes Argument) oder man könne nicht aus der Reihe des Fakultätentages tanzen usw. Wem die Bettelei in einer solchen scheinbar [!] „eigenen Sache“ nicht auf Dauer liegt, der hat immerhin noch die Chance, sich darauf zu verlegen, die Studierenden zu motivieren und sich an ihrem freiwilligen Engagement in der Sache zu freuen. Langfristig ist dies jedoch keine tragfähige Grundlage. Man wird angesichts kirchlicher Prüfungshoheit und kirchlicher Selbstverpflichtung von den Landeskirchen aus nach Wegen suchen müssen, wie sich auf der Ebene der Pflicht – und nicht nur der Kür – bestimmte minimale Kenntnisse und Einsichten über Judentum und christlich-jüdisches Verhältnis vermitteln lassen, damit das Manko der Fakultäten nicht eines Tages auf die Landeskirchen zurückfällt und es dann vielleicht mit Recht heißt: „Misstraut den Kirchen, auch wenn sie Erklärungen bringen!“ (2) Der zweite Punkt ist praktischer und theoretischer Natur zugleich. Ich meine den seit einiger Zeit lauter und häufiger werdenden Ruf nach Normalisierung der christlich-jüdischen Beziehungen. Er verdient besonders sensible Aufmerksamkeit, da er eine Mischung von real vorhandenen Problemen und seltsamer Realitäts- und Geschichtswahrnehmung ist. Denn was sollte nach dem, was vor knapp zwei Generationen bei uns mit allen Folgeerscheinungen geschehen ist, was sollte danach an den deutsch-jüdischen/deutsch-christlichen Beziehungen normal sein können? Man könnte hier überhaupt nur weiter diskutieren, wenn man klärte, was mit der sogenannten Normalisierung gemeint sein soll. Sonst ist man bereits in die Begriffsfalle getappt. Geht man ihr aus dem Weg, dann ist im Gegenzug als Erstes festzustellen, dass die Anerkennung der nach wie vor gegebenen Anormalität des Verhältnisses die Voraussetzung dafür ist, dass in der Gegenwart das Verhältnis angemessen gestaltet werden und dadurch Festigkeit gewinnen kann. Schuld behelligt nicht nur das Gespräch, sie würgt es ab. Sie führt in Befangenheit. Sie beschämt oder fördert den Hochmut. Immer beeinträchtigt sie die Freiheit der redlichen, gelassenen Auseinandersetzung ... Wobei es durchaus eins ist, wer wessen Schuld wem gegenüber trägt. Beschuldigung wirkt ebenso destruktiv wie Entschuldigung, Fremdbeschuldigung nicht minder als Selbstbeschuldigung.34 Das klingt psychologisch schlüssig, und ganz gewiss wird man mit Nachdruck im Hinblick auf die nachwachsenden Generationen unterstreichen müssen, dass es völlig verfehlt wäre, ihnen eine Schuld an Geschehnissen zu suggerieren, für die sie keine Verantwortung tragen. Trotzdem bleibt die Frage, wie verantwortlich einzuweisen ist in das Verhältnis zur eigenen Geschichte, zur Abfolge der vorangegangenen Generationen, mit denen man zum Beispiel in Erbfragen ganz gern enger zusammenhängt. Könnte man es ernsthaft von der Hand weisen, dass wir Christen in Deutschland oder auch wir nichtjüdischen Deutschen gegenüber den jüdischen Deutschen oder auch gegenüber der jüdischen Gemeinschaft eine besondere Pflicht haben – nämlich dazu beizutragen, dass auf beiden Seiten Vertrauen wächst als Voraussetzung eines anderen Miteinanders? Was müssen wir tun, damit der Faden entsprechender Bemühungen nicht abreißt, nicht nur unter den Theologiestudierenden, sondern eben überhaupt im Blick auf die jüngeren Generationen? Denn wenn man nicht im Zeitmaß von Wahlperioden denkt, dann haben wir mit dem Bestreben, ein anderes Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft zu gewinnen, überhaupt erst begonnen. Was hat sich, um das Tagungsstichwort aufzunehmen, in der zurückliegenden Anfangszeit „auf dem Weg zu einem neuen christlichen Selbstverständnis“ geändert? Am wenigsten willkürlich dürfte eine Antwort sein, die sich an den kirchlichen Erklärungen der letzten 25 Jahre orientiert. Wenn man sie in bonam partem interpretiert, dann geben sie mehr oder weniger insgesamt vor allem eine Absage an christlichen Absolutismus oder an religiöses Anspruchsdenken zu erkennen, wie es mit christlichem Absolutismus traditionell aufs Engste verbunden ist. Es scheint, dass zugesagte Teilhabe an der Wahrheit, d.h. an der Wirklichkeit Gottes, nicht länger als ein andere dominierender Wahrheitsbesitz verstanden wird, der das Recht gibt, die eigene Identität auf Kosten des anderen zu definieren. Wie weit diese Bereitschaft bereits in der Breite wirksam ist, ist gewiss eine andere Frage. Was lässt sich tun, um die Fortbewegung in der damit eingeschlagenen Richtung zu fördern? Am ehesten dürfte ein sensibler, von dem Versuch zu verstehen geleiteter Umgang mit beiden Fragen hilfreich sein, derjenigen nach den gemeinsamen Wurzeln, nach dem Verbindenden zwischen Juden und Christen einerseits und der Frage nach dem, was beide unterscheidet oder auch trennt und was ihnen ihre je eigene Kontur gibt, andererseits. ZWEI GRUPPEN AUF BEIDEN SEITEN EINES BREITEN STROMES Gegenüber einem überbetonten Plädoyer für ein disentanglement ist entsprechend festzuhalten: In dem Maße, in dem das uns Verbindende gesucht wird, können wir auch mit dem uns Unterscheidenden leben, ohne dass durch die Betonung der Unterschiede das besondere Verhältnis zwischen Christen und Juden beeinträchtigt oder aufgelöst wird. Wollte man die entfalteten Grundlinien in ein Bild fassen, so könnte man dialogbereite Christen und Juden mit zwei Gruppen vergleichen, die auf beiden Seiten eines breiten Stromes dahinziehen. Seine Wasser werden gespeist von den gemeinsamen biblischen Traditionen und von der gemeinsamen Geschichte mit ihren manchmal verheißungsvollen Seiten und mit ihrem Elend, wie es vor allem christlicherseits verschuldet wurde. So werden beide Gruppen durch den Strom zugleich verbunden und getrennt. Beide haben sich entschieden, künftig in Sichtweite auf den Ufern weiterzugehen und sich nicht aus den Augen zu verlieren. Manchmal, in seltenen Augenblicken, treffen sie sich auf einer der Brücken, die sie in Abständen über den Fluss schlagen, um für eine Weile gemeinsam zu lernen, gelegentlich auch zu streiten oder zusammen die Lieder zu singen, die sie miteinander teilen.
ANMERKUNGEN
1 In: Kirche und Israel (KuI) 1, 1986, 11-15.
2 Ebd., 15.
<fussnote 3> So die vielzitierte Klassifizierung des christlichen Antijudaismus durch JULES ISAAC, Jesus und Israel, Wien/Zürich 1968; ders.:
„Hat der Antisemitismus christliche Wurzeln?“ in: EvTh 21, 1961, 339-354.
4 CHRISTINA KURTH/PETER SCHMID (Hg.), Das christlich-jüdische Gespräch. Standortbestimmungen, Stuttgart 2000.
5 Ebd., 101-135.
6 Ebd., 137-170.
7 Ebd., 124-135.
8 Ebd., 124.
9 Ebd., 124.
10 Ebd., 124.
11 Alle Zitate ebd., 124.
12 Ebd., 126.
13 Ebd., 131.
14 Ebd., 135.
15 JONATHAN SACKS, “The Dignity of Difference”, in: Common Ground 113, 2002, 3-6.
16 Ebd., 6.
17 JOHN D. LEVENSON, „Wie man den jüdisch-christlichen Dialog nicht führen soll“, in: KuI 17, 2002, 163-174 (s. Begegnungen, Heft 3,
2002, 13-20).
18 TanB, Ki Tissa 34 zu Ex 34,27; Übers. mit Levenson ebd., 170 (eckige Klammern von Peter von der Osten-Sacken). Der Rahmen – die
Frage, warum die Mischna am Sinai nicht schriftlich gegeben worden ist – ist hier anders als bei Levenson weggelassen.
19 Vgl. den Ruf „Geheimnis des Glaubens!“ in der katholischen Abendmahlsliturgie und zur Alten Kirche GEOFFREY W.H. LAMPE (Hg.), A
Patristic Greek Lexicon, Oxford 111994, 892f.
20 Nachdruck des Gesprächs in: PETER VON DER OSTEN-SACKEN (Hg.), Leben als Begegnung. Ein Jahrhundert Martin Buber (1878-1978), Berlin
21982, 119-135. Die zitierte Wendung findet sich in dem nachstehenden Zitat.
21 Ebd., 129 (das Wort in {} ist von Buber im Rahmen des Zweitdrucks des Beitrags ergänzt).
22 Ebd., 132.
23 Vgl. meinen Beitrag: „Zum gegenwärtigen Stand des jüdisch-christlichen Dialogs und seinen Perspektiven“, in: RAINER
KAMPLING/MICHAEL WEINRICH, Dabru emet – redet Wahrheit. Eine jüdische Herausforderung zum Dialog mit den Christen, Gütersloh 2003,
206-218, hier 214.
24 BUBER in: VON DER OSTEN-SACKEN 21982 (s.o. Anm. 21), 127f, in Aufnahme eines Wortes aus dem rabbinischen Traditionswerk Seder
Eliahu Rabba Kap. 10 (hier nach der von Max Friedmann herausgegebenen Ausgabe, Wien 1901, 48).
25 Ebd., 127.
26 BUBER in: VON DER OSTEN-SACKEN 21982 (s.o. Anm. 21), 121.
27 Vgl. seine Schrift Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950.
28 Der apokalyptische Horizont des paulinischen Evangeliums ist vor allem von Albert Schweitzer und Ernst Käsemann mit Recht
hervorgehoben worden.
29 DIETRICH RITSCHL, Zur Logik der Theologie, Neuauflage München 1988, 46.
30 Aus der Fülle der bereits vorhandenen Literatur vgl. besonders K. KOCH, „Der doppelte Ausgang des Alten Testaments in Christentum
und Judentum“, in: JBTh 6, 1991, 215-242; sodann als zusammenfassende Orientierung CHRISTOPH DOHMEN/GÜNTER STEMBERGER, Hermeneutik der
Jüdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart u.a. 1996, sowie als jüngeren Beitrag MATTHIAS LOERBROKS, Weisung vom Zion.
Biblisch-theologische Orientierungen für eine Kirche neben Israel, Berlin 2000.
31 Zur Sache vgl. ERNST VON DOBSCHÜTZ, „Vom vierfachen Schriftsinn. Die Geschichte einer Theorie“, in: Harnack-Ehrung: Beiträge zur
Kirchengeschichte ihrem Lehrer Adolf von Harnack zu seinem siebzigsten Geburtstag (7.Mai 1921) dargebracht von einer Reihe seiner
Schüler, Leipzig 1921, 1-13.
32 Vgl. in diese Richtung gehende Andeutungen bei Augustin und hierzu HENNING GRAF REVENTLOW, Epochen der Bibelauslegung, Bd. II,
München 1994, 91f.95.
33 FRIEDRICH GLEISS, „Außerhalb des Blickfeldes. Das Judentum kommt im Theologiestudium und in der Pfarrpraxis kaum vor“, in: LM 33,
1994, 9f. Vgl. hierzu auch PETER VON DER OSTEN-SACKEN, „Christen und Juden an der Jahrhundertwende“, in: ders. (Hg.), Das mißbrauchte
Evangelium. Studien zu Theologie und Praxis der Thüringer Deutschen Christen, Berlin 2002, 11-34, hier 13f.
34 KURTH/SCHMID 2000 (s.o. Anm. 5), 133.
Der Autor
ist Professor für Neues Testament und Christlich-Jüdische Studien an der Humboldt-Universität und Leiter des Instituts Kirche und Judentum in Berlin. Im Rahmen der Eröffnung der "Woche der Brüderlichkeit" am Sonntag, 6. März 2005, erhalten er und das Institut Kirche und Judentum in Anerkennung ihrer außerordentlichen Beiträge für die Verständigung zwischen Christen und Juden die Buber-Rosenzweig-Medaille.