ONLINE-EXTRA Nr. 349
© 2024 Copyright bei Verlag und Autorin Der Beitrag ist versehen mit einer CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0.
Abraham Jehoschua Heschel, am 11. Januar 1907 in Warschau geboren und am 23. Dezember 1972 in New York City gestorben, gehört zu den einflussreichsten Pionieren des christlich-jüdischen Dialogs nach dem Holocaust. Auch wenn seine Bekanntheit in den USA und der englischsprachigen Welt (leider immer noch) sehr viel größer als hierzulande ist, ist sein enormer Einfluss auf die Entwicklung des christlich-jüdischen Dialogs auch in der deutschsprachigen Welt kaum zu überschätzen.
Heschel verkörpert wie kaum ein anderer jüdischer Denker des 20. Jahrhunderts in seiner Person gesellschaftliches Engagement und tiefe Frömmigkeit, einen ausgeprägten Sinn für Moralität verbunden mit einer intensiven Spiritualität. Noch 1933 in Berlin promoviert flüchtet Heschel anschließend in die USA, wo er nach 1945 mit seinen Publikationen in den 50er Jahren für Aufsehen sorgt: "Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums" (1952); "Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen" (1951), und "Der Mensch fragt nach Gott. Untersuchungen zum Gebet und zur Symbolik" (1954). Neben seinem gesellschaftspolitischen Engagement in der amerikanischen Bürgerbewegung, Seite an Seite mit Martin Luther King Jr., war sein theologisches Bemühen von der tiefen Überzeugung geprägt, dass Judentum und Christentum unverbrüchlich miteinander verflochten sind.
Seine Tochter, Susannah Heschel, die in den letzten Jahrzehnten auf den Spuren ihres Vaters selbst zu einer markanten Größe im christlich-jüdischen Dialog geworden ist, zeichnet in dem nachfolgenden Beitrag das literarische Werk und die Persönlichkeit ihres Vaters auf eindrucksvolle Weise und mit mancherlei privaten Erinnerungen versehen nach. Dabei setzt sie ihren Fokus just auf den christlich-jüdischen Aspekt, was auch programmatisch im Titel ihres Beitrags zum Ausdruck kommt: "Das Engagement von Rabbi Abraham Joshua Heschel für Christ:innen und für die christliche Theologie". Susannah Heschels Beitrag, der nachfolgend als ONLINE-EXTRA Nr. 349 zu lesen ist, erschien im Rahmen einer dem Werk und Leben Abraham Jehoschua Heschels gewidmeten Ausgabe der unbedingt empfehlenswerten "Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung im Kontext" (2-3/2023). Nähere Angaben hierzu sowie zur Autorin weiter unten und am Ende des Textes.
online für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 349
Wie sprechen Jüd:innen nach der Schoah zu Christ:innen über das Christentum?1
Wir befinden uns »an den Grenzen verfügbarer Ontologien, verfügbarer Schemata der Verstehbarkeit… Wie kommt es, dass die Erniedrigten ihre Ansprüche durch und gegen die Diskurse geltend zu machen versuchen, die ihre Erniedrigung angezielt haben?« 2, so fragt die jüdische Philosophin Judith Butler.
Es ist bemerkemswert, dass die Schoah meinen Vater nicht vom Christentum entfremdete und ihn auch nicht verächtlich, bitter oder zornig machte, sondern ihn im Gegenteil zu der Überzeugung brachte, dass wir zueinander finden müssen. Der Nationalsozialismus hat eine Niederlage erlitten, so schreibt er, aber es sei unser aller Aufgabe, »die Ausstrahlung der hebräischen Bibel zu retten«, die Gegenwart Gottes, das beständige Bemühen, die Gleichgültigkeit der Menschen zu überwinden. »Unser Gewissen ist stumm wie eine Wand… Die Märtyrer brauchen nicht unsere Rezitationen des Kaddisch, sondern wir brauchen jemanden, der das Kaddisch über uns und für uns rezitiert, weil wir unsere Seelen eingebüßt haben«, denn das Gegenteil des Guten ist nicht das Böse, sondern die Gleichgültigkeit.
Die warmherzige Rezeption, die das Werk meines Vaters unter Christ:innen, besonders unter Katholik:innen erfahren hat, bedeutet eine außerordentliche Entwicklung in der Geschichte des Westens. Wie kam es dazu?
Joshua Furnal betonte, »ohne Rabbi Heschel wäre es fraglich, dass Nostra Aetate die Gestalt angenommen hätte, die es tatsächlich hatte.«3
Ich staune über die engen Freundschaften meines Vaters mit einzelnen christlichen Theologen und die Bandbreite der entsprechenden Menschen: Kardinal Bea wie auch die Brüder Berrigan; Thomas Merton, Leo Rudloff und Richard John Neuhaus; Dorothy Day genauso wie Monsignore Felix Morlion; ebenso Protestanten, vor allem seine Kollegen am Union Theological Seminary, besonders WD Davies, und Pastoren, zu denen Martin Luther King Jr., William Sloan Coffin und Albert Cleage gehörten. Es ist erstaunlich, dass Reinhold Niebuhr, der wichtigste amerikanische Theologe des 20. Jahrhunderts, meinen Vater bat, die Würdigung bei seiner Beerdigung zu übernehmen. Sie alle erkannten an, dass mein Vater dem Christentum mit tiefer Achtung gegenüberstand, und ihre Freundschaften waren tiefgehend.
Sie machen sich hoffentlich klar, wie erstaunlich es war, dass mein Vater, der aus einer sehr frommen chassidischen Familie in Warschau stammte, seine freundschaftlichen Beziehungen zu Christ:innen wertschätzte. Während der Jahre, in denen mein Vater an Konsultationen mit Vertretern des Vatikans über Nostra Aetate beteiligt war, engagierte er sich auch intensiv in der Bürgerrechtsbewegung, auch einer ökumenischen Bewegung.
Machen Sie sich einen Begriff davon, was es für meinen Vater, der von 1927 bis 1938 in Deutschland gelebt hatte, bedeutete, christliche Theologen mit einer tief verwurzelten Achtung für das Judentum zu treffen! Als mein Vater in Deutschland lebte, wollten einige protestantische Theologen das Alte Testament aus der Bibel streichen, weil es ein jüdisches Buch sei. Manche erklärten, Jesus sei ein germanischer Arier, kein Jude gewesen; einige bezeichneten Hitler als christusähnliche Gestalt und schrieben die Bergpredigt in militärischem Sinn um.4 In den USA betrachtete die Schwarze Kirche den Exodus und die Propheten als für das Christentum zentral.
Seit ihrer ersten Begegnung im Januar 1963 wurden mein Vater und Martin Luther King enge Freunde, die oft zusammen bei Vorträgen auftraten und schließlich gemeinsam gegen den Krieg in Vietnam protestierten. Ungeachtet ihres radikal unterschiedlichen Hintergrunds sind ihre theologischen Berührungspunkte bemerkenswert. Was führte sie zusammen? Die Strahlkraft der Bibel, die Propheten und das Gebet.
Andere empfanden das Gleiche bezüglich meines Vaters. Beispielsweise schrieb Kardinal Bea nach ihrem ersten Zusammentreffen im November 1961: »Es (existiert) zwischen uns ein starkes, gemeinsames spirituelles Band.«5
Wir wollen daran erinnern, dass solche Freundschaften in unserer Geschichte selten waren. Die Pastoren, Priester und Nonnen, die zu uns nach Hause zum Essen am Sabbat und zum Seder an Pessach kamen, waren tief beeindruckt von den Gebeten meines Vaters am Tisch. Als Kind konnte ich die Scheu wahrnehmen, die sie empfanden, als sie Zeugen der Gebete eines Juden waren und sich dessen bewusst wurden, dass sie etwas über Gott vom Judentum lernen konnten.
Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung im Kontext (ZfBeg)
Wie lässt sich eine spirituelle Beziehung pflegen? »Zeige uns, wie ihr betet«, baten die Mönche beim Besuch meines Vaters im Benediktinerpriorat in Weston in Vermont. Unsere Worte beim Gebet können verschieden sein, aber unser Gebet ist das gleiche. Erst kommt das Beten, dann der Glauben. Ja, wir unterscheiden uns in Vorschriften und Bekenntnissen, aber wir sind darin eins, dass sich Gott um uns kümmert. Unsere Sprache kann verschieden sein, »aber die Schwierigkeiten sind dieselben, genauso wie der Seufzer, die Furcht und das Zittern, ebenso wie das Gewissen.«6
Mein Vater verbrachte die Kriegsjahre allein in Cincinnati, wo er am Hebrew Union College lehrte; das College hatte das Visum besorgt, dem er seine Rettung verdankte. Er versuchte verzweifelt, seine Mutter, drei Schwestern, Verwandte und Freunde zu retten, die in Europa festsaßen und war erschüttert von der Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Schicksal bei Jüdinnen/Juden wie bei Christ:innen. Wie er später erzählte, setzte er sich für sie ein, beteiligte sich an Demonstrationen, ohne Erfolg, keiner wollte es hören. »Ich war ein Fremder in diesem Land. Meine Meinung fiel nicht ins Gewicht. Man nannte mich einen Mystiker, keinen Realisten. Ich betete Psalmen, fastete und schrie mir die Seele aus dem Leib.«7
Die Bücher eines Theologen sind ein Fenster in die Seele ihres Verfassers; so lernen wir meinen Vater durch seine Schriften kennen. »Wir alle haben eine schreckliche Einsamkeit gemeinsam«, schrieb er 1942 in dem »Eine Analyse der Frömmigkeit« betitelten Artikel. »Die Wurzel der Religion ist die Frage, was wir mit dem Empfinden des Geheimnisses des Lebens anfangen, wie wir mit Schrecken, Wunder oder der Furcht umgehen. Religion, das Ende der Isolation, beginnt mit dem Bewusstsein, dass etwas von uns gefordert wird.« Leben ist kein Geschenk, sondern ein Auftrag. Leben ist Zeit, und er stellte sich die Frage, was Gott von mir fordert, was die Welt zu dieser Zeit braucht. Er spürte, dass er nicht isoliert leben konnte, weder als chassidischer Rabbi, noch als von den Problemen der Welt abgesonderter Gelehrter.
Während der Kriegsjahre verfasste mein Vater verschiedene Artikel über Frömmigkeit und Gebet. In einem davon schrieb er: »Das Gebet beginnt dort, wo das Ausdrücken fehlschlägt. Die Worte, die unsere Lippen erreichen, sind oft nur Wellen einer überfließenden Strömung, die den Strand bespielt.« Wir leben im Sehnen, formuliert er, in der Hoffnung, der Welt zu entkommen, vielleicht auch unseren eigenen Gedanken, und entdecken unser Selbst. Gebet ist weder Selbstgespräch noch Dialog, sondern »das Bemühen, Gegenstand der Gedanken Gottes zu werden« (MGSA 345), von Gott verstanden, erkannt zu werden. Gott liebt das, was am Grund des Herzens übrig geblieben und nicht in Worten auszudrücken ist. Das unaussprechliche Empfinden erreicht Gott eher als der ausdrückliche. Wenn wir Gott verlassen, ist nicht er allein, sondern sind wir es.
Mein Vater vergleicht das Beten mit dem Träumen. Psalm 126,1 beginnt mit dem Satz Schir Hama’lot: B’schuv Adonai et schivat Ziom hayinu k’chomim (»Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende.«) Mein Vater schreibt: »Beten bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott zu träumen, der heiligen Visionen Gottes ansichtig zu werden« (Heschel, Man’s Quest, p. 19). Die Fähigkeit zum Beten ist eine Antwort auf die Einsamkeit; sie ist eine Gabe von Gott und verändert unser Leben. Psalm 66, 20 dankt Gott: »Gepriesen sei Gott; denn er hat mein Gebet nicht verworfen und mir seine Huld nicht entzogen.« Noch mehr: Der Psalmist schreibt, dass ich beim Beten zum Gebet werde: Psalm 109,4 v’ani tefilla (»Ich bin Gebet«).
Gebet ist nicht Abschließung oder Rückzug von der Welt. »Das Gebet ist bedeutungslos, wenn es nicht subversiv ist, nicht die Pyramiden von Schweigsamkeit, Hass, Opportunismus, Falschheiten zu überwinden und zu zerstören trachtet« (MGSA 262), Gott braucht uns.
Als er vom Marsch für Bürgerrechte in Selma im Jahr 1965 zurückkam, sagte er: »Für viele von uns ging es beim Marsch von Selma nach Montgomery um Protest und Gebet. Beine sind keine Lippen, und Gehen ist nicht Knien. Und doch kamen aus unseren Beinen Lieder. Auch ohne Worte war unser Marsch ein Gottesdienst. Ich spürte, wie meine Füße beteten.« Hier treten die tiefen Verbindungen meines Vaters mit Dorothy Day, Thomas Merton, Martin Luther King und Papst Franziskus unmittelbar zutage.
Mein Vater pflegte zu sagen, Judentum wie Christentum bräuchten mehr Jerusalem und weniger Athen, und in seiner Philosophie spiegelte sich sowohl das Apophatische wie das Kataphatische. Letztendlich ging es weniger um lehrmäßige Formulierungen als um die Schaffung eines neuen Geistes, einer Fähigkeit, Gottes Gegenwart wahrzunehmen.
Der Krieg markierte eine Veränderung in den Veröffentlichungen meines Vaters über das Christentum. Seine im Dezember 1932 fertiggestellte Dissertation über die Propheten ist eine scharfe Distanzierung gegenüber der deutschen protestantischen Bibelwissenschaft; dieses Thema spielt später keine Rolle mehr.
Sein Ton verwandelte sich. In seinen Nachkriegsveröffentlichungen zeigte mein Vater weder Interesse an den mittelalterlichen jüdischen Debatten darüber, ob die Trinität Götzenverehrung sei, noch versuchte er, die jüdische Ablehnung Jesu zu rechtfertigen. Er ließ sich nicht von den Verdikten von Rabbi Norman Lamm einschüchtern, der schrieb, die Aufhebung des Vorwurfs des Gottesmords durch das Zweite Vatikanum sei »ein Werkzeug zum Abbau des jüdischen Widerstands… gegen die Konversion zum Katholizismus«; genauso wenig von Rabbi Mosche Feinstein, der jedes jüdische Engagement im Dialog mit Christ:innen ablehnte. Er schloss sich auch nicht Martin Buber mit seinem Bekenntnis »Jesus ist mein Bruder« an, und mein Vater beteiligte sich auch nicht an dem populären modernen jüdischen Bemühen, Jesus für das Judentum zu beanspruchen und Paulus dafür zu tadeln, dass er das Christentum geschaffen habe. In seinem Werk fehlt auch jeder apologetische Ton; gibt es keinerlei Versuche, Luther, Troeltsch, Kant oder andere Kritiker des Judentums abzuschwächen. Bei der Beschäftigung mit einigen der Traditionen in der christlichen Theologie, die das Judentum negieren, schreibt er, sie würden das Christentum herabsetzen.
In der Nacht vor dem unerwarteten Tod des katholischen Theologen Gustav Weigel war er bei ihm und fragte ihn: »Ist es wirklich der Wille Gottes, dass es auf der Welt kein Judentum mehr gibt? Wäre es wirklich ad Majorem Dei gloriam, eine Welt ohne Juden zu haben?«
Und er appelliert an Jüdinnen und Juden, dem Christentum dafür dankbar zu sein, dass es jüdische Texte bewahrt und die moderne Bibelwissenschaft hervorgebracht, die Bibel und den Gott Abrahams der Welt geschenkt habe, ebenso für christliche Theologen, die zur Inspirationsquelle für viele Jüdinnen und Juden geworden seien.
Wenn mein Vater über interreligiöse Themen las, zitierte er nur positive jüdische Texte über das Christentum. Er sprach nicht über die Schoah und sehr wenig über christlichen Antijudaismus. Sein Interesse galt immer Parallelen und möglichen geschichtlichen Einflüssen, als er etwa an Kardinal Bea schrieb, es habe vor der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts keine Theorie eines göttlichen Diktats der Heiligen Schrift existiert, und es gebe bei den Rabbinern sehr unterschiedliche Sichtweisen von Offenbarung. Ihm zufolge ähnelten die Theorien der protestantischen Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts stark der Sichtweise von Rabbi Akiba.
Mein Vater betonte ständig, letztlich komme es für die Beziehungen zwischen den Glaubensrichtungen weder darauf an, Differenzpunkte zu diskutieren, noch auf die Suche nach Parallelen in der Lehre, sondern darauf, so schrieb er in der Schlussbetrachtung von »No Religion is an Island«, »in dem Versuch zusammenzuarbeiten, eine Wiederbelebung von Sensibilität, eine neue Besinnung auf das Gewissen zu Stande zu bringen; die göttlichen Funken in unserer Seele lebendig zu erhalten, die Offenheit für den Geist der Psalmen zu pflegen, Achtung gegenüber den Worten der Propheten und den Glauben an den lebendigen Gott.«
Er legte den Schwerpunkt auf das Positive, indem er Maimonides mit seiner Aussage zitierte, Christentum und Islam seien ein Teil von Gottes Plan zur Errettung der Menschheit. Auch wenn Christ:innen die Torah anders deuteten, würden sie trotzdem »glauben und bekennen, dass die Torah Gottes Offenbarung ist.«
Er zitiert ausführlich Rabbi Jakob Emden, einen angesehenen Rabbiner des 18. Jahrhunderts aus dem damals dänischen Altona, der erstaunlich positive Bewertungen sowohl des Christentums wie des Islam zu Protokoll gab. Emden schreibt: »Jesus brachte eine doppelte Güte in die Welt. Auf der einen Seite bekräftigte er eindrucksvoll die Torah des Moses … und keiner von unseren Weisen äußerte sich nachdrücklicher im Blick auf die Unveränderbarkeit der Torah.« In Emdens Kommentar zu Pirke Avot, dem 1751 veröffentlichten Etz Avot, bekräftigte er seine Aussagen. Im Kommentar zu Pirke Avot 4,11: »Jede Versammlung, die um des Himmels willen zusammentrifft, wird eine andauernde Auswirkung haben« (»knessiyah leschem schamaim, schesofah lehitkayem«) (Avot 4,11; 5,17)8 schreibt Emden, »eine Gemeinschaft, die um des Himmels willen zusammenkommt, schließt Christentum und Islam ein«, die aus dem Judentum entstanden seien und »die Grundlagen unserer göttlichen Religion« akzeptieren würden, »Gott unter den Nationen bekannt zu machen… zu verkünden, dass es einen Meister im Himmel und auf Erden gibt, die göttliche Vorsehung, Belohnung und Strafe … der die Gabe der Prophezeiung verleiht … und sich durch die Propheten, Gesetze und Vorschriften für die Lebensführung mitteilt.«9
Er betonte, das interreligiöse Verhältnis beginne mit dem Glauben; es sei bedeutungslos für Jüdinnen und Juden, zu proklamieren, Christ:innen bejahten Gott und die Propheten, wenn sie selbst ihren Glauben verloren hätten.
Probe-Abonnement
Nahost/Israel, Gedenken und Erinnern, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, multikulturelle Gesellschaft, christlich-jüdischer und interreligiöser Dialog, jüdische Welt. Ergänzt von Rezensionen und Fernseh-Tpps!
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
Die englischen Bücher meines Vaters erschienen nach den Zweiten Weltkrieg für ein amerikanisches jüdisches Publikum, das in der von Mordechai Kaplan vertretenen jüdischen Spielart der Chicago School von Theologie beheimatet war. Damals wollten sich amerikanische Jüdinnen und Juden modernisieren und säkularisieren und waren der festen Auffassung, dass die Tage der Orthodoxie bald vorbei sein würden. Aus der Soziologie hörten wir, der heilige Baldachin sei erschüttert und Psychoanalytiker:innen warnten uns, Religion sei eine Form des ungesunden Masochismus.
Mein Vater war eine ausgeprägte neue Stimme, sehr verschieden von anderen modernen jüdischen Denkern. Er war tiefer in allen Quellen des Judentums verwurzelt; kein anderer jüdischer Theologe kannte wie er die breite Reihe der klassischen jüdischen Texte. Das ließ ihn auch jüdischen Lesern fremd erscheinen, die nichts davon wussten, dass sich im Talmud theologische Diskussionen über Offenbarung finden oder dass die ta’anei hamitzwot der Kabbala, die Begründungen für die Gebote, auf das rabbinische Verständnis der zoreh gawoha, die göttliche Notwendigkeit, zurückgingen. Dass Gott die Erlösung braucht, ist integrierender Bestandteil des Talmud und der Liturgie, auch wenn eine solche Abweichung von einem im aristotelischen Sinn allmächtigen Gott für manche Juden häretisch zu sein schien. Göttliche Leidenschaft, göttliches Mitleiden mit menschlichen Wesen, das war Theopaschitismus, der in der frühen Kirche als häretisch verurteilt worden war, aber dennoch für schwarze Theolog:innen in den Vereinigten Staaten kongenial war, deren Verständnis der Propheten dem Denken meines Vaters am nächsten kommt. Wer unter Rassismus leidet, versteht die prophetische Verurteilung von fehlender Anerkennung. Jenen Polizisten, die behaupten, sie seien keine Rassisten, aber Schwarze ermorden und so gerade den Rassismus praktizieren, den sie ablehnen, sagt Jesaja: »Du hast dich auf deine bösen Taten verlassen / und gedacht: Es sieht mich ja keiner. Deine Weisheit und dein Wissen verleiteten dich, in deinem Herzen zu denken: / Ich und keine sonst!« (Jes 47, 10 [EÜ]).
Jenen, die ausbeuten und betrügen und dadurch finanzielle Katastrophen auslösen; jenen Politikern, die behaupten, sie glaubten an das Lebensrecht, aber gleichzeitig die Grundbedürfnisse zur Lebenserhaltung mit Füßen treten: Ernährung, medizinische Versorgung, Wohnung, Erziehung, sagt Jeremia: »Selbst am Saum deiner Kleider fand sich das Blut von Armen, von Unschuldigen, die du nicht etwa beim Einbruch ertappt hast. Ja, es fand sich sogar noch mehr. Und trotzdem sagst du: Ich bin unschuldig; sein Zorn hat sich ja von mir abgewandt. – Aber ich gehe ins Gericht mit dir, weil du sagst: Ich habe mich nicht versündigt.« (Jer 2,34f. [EÜ]).
Schweigen, Lügen, Indifferenz. Mein Vater sagte: »Wir leben in einer gottlosen Welt. Wenn wir noch ein Herz hatten, ist es zu Stein geworden. Ich sitze oft da und überlege: Vielleicht sind unsere Seelen mit ihren Leibern zusammen in Majdanek und in Auschwitz in Flammen aufgegangen.«
Es war die grundlegende Hoffnung meines Vaters, die katholische Kirche würde die Heiligkeit im Judentum als Quelle des Segens für Christ:innen anerkennen. Aber die Heiligkeit des Judentums kann nur anerkannt werden, wenn die Kirche dem Proselytismus absagt und stattdessen Jüdinnen und Juden als diejenigen versteht, die ununterbrochen im Bund mit Gott stehen. Aber diese Heiligkeit benötigt auch eine Revitalisierung im Judentum. Mein Vater war in hohem Maß kritisch gegenüber dem jüdischen Leben in Amerika – nicht nur im Blick auf den Säkularismus, sondern auch auf die Oberflächlichkeit von Predigten, die Passivität der Gottesdienstbesucher, das Fehlen von Ernst, die Vulgarität einiger Bat-Mitzwah-Feiern. Er beschrieb die großen, neuen amerikanischen Synagogen in den Vorstädten als Friedhöfe, in denen das Gebet abstirbt. Die Abnahme von Religion in der modernen Welt geschieht nicht nur aufgrund der Herausforderungen durch Naturwissenschaft und Philosophie, so formuliert er auf der ersten Seite von »God in Search of Man«, sondern weil ihre Botschaft schal geworden ist.10
Er sagte einmal, Jüdinnen und Juden seien Botschafter, die die Botschaft vergessen hätten. Wie können wir wieder Tritt fassen? Er zeigt, dass keine Religion eine Insel ist; wenn im Lauf der Geschichte die Christ:innen fromm waren, waren auch ihre jüdischen Nachbarn fromm. Wir beeinflussen uns gegenseitig. »Spirituelle Treulosigkeit bei einem Teil von uns beeinflusst den Glauben von uns allen.« Wir leben nicht in Isolation: »Wir müssen wählen zwischen gemeinsamem Glauben und gemeinsamem Nihilismus.«
»Das Wichtigste ist heute, ob wir gegenüber der Herausforderung und Erwartung des lebendigen Gottes lebendig oder tot sind. Die Krise bedrängt uns alle. Das Elend und die Furcht vor einer Entfremdung gegenüber Gott lässt Jüdinnen/Juden und Christ:innen gemeinsam aufschreien.« Wie können wir einander helfen?
Die Betonung meines Vaters auf das, was wir gemeinsam tun könnten, wird in den Worten von Papst Franziskus neu bekräftigt. Wir hätten »ein gemeinsames spirituelles Gedächtnis«, formulierte Papst Franziskus in einer Ansprache an eine Delegation von B’nai B’rith International am 30. Mai 2022. »Angesichts der Gewalt, der Indifferenz, zeigen uns die Seiten der Heiligen Schrift das Gesicht unserer Brüder und Schwestern. Sie konfrontieren uns mit der ›Herausforderung des Anderen‹. Das ist der Maßstab unserer Treue zu dem, was wir sind, zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit: Sie wird gemessen an unserer Brüderlichkeit, an unserer Sorge für die Anderen. Gott fragt Kain: Wo ist dein Bruder?, so wie er Adam gefragt hat: Wo bist du? (Gen 3,9). Beide Fragen sind durch die gleiche Frage verbunden: Wo? Wir können nicht voll und ganz wir selbst sein, ohne uns um unsere Brüder und Schwestern zu sorgen. Wir können den Ewigen nicht finden, ohne uns unserem Nachbarn zuzuwenden.« Das Zweite Vatikanum machte uns zu Nachbarn.
Mein Vater traf mit Kardinal Bea zum ersten Mal am Sonntag, dem 26. November 1961, in Rom zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater und Kardinal Bea wussten, dass sie beide an der Berliner Universität bei dem gleichen Professor für Semitistik, Eugen Mittwoch, studiert hatten, Bea 1913, mein Vater 1927 bis 1933. Sie wissen vielleicht, dass Kardinal Bea als Theologe, der sich mit der Offenbarung befasste, auch die hebräischen Midrasch-Kommentare zum Hohen Lied studierte. Mein Vater gab ihm eine besondere Ausgabe des Midrasch, in der Rabbi Akiba den berühmten Spruch formuliert, dass die ganze Welt, olam, nicht so wichtig ist wie der Augenblick, in dem das Hohe Lied Israel übergeben wurde. Bei ihrem Treffen machte mein Vater den Vorschlag, olam mit »Zeit« zu übersetzen. Er sagte, wir hätten eine prophetische Verantwortung gegenüber der Zeit, zum Erkennen dessen, was in einem besonderen Augenblick wichtig sei. »Judentum und Christentum ist der Glaube der Propheten gemeinsam, dass Gott Handelnde auswählt, durch die sein Wille bekannt gemacht und seine Aufgabe die Geschichte hindurch getan wird.«
Bei ihrem Treffen bat Kardinal Bea meinen Vater um die Vorbereitung eine Memorandums, das er im Mai 1962 ablieferte. Mein Vater schrieb, er hoffe, das Zweite Vatikanum werde die »Integrität und den bleibenden Wert« der Juden als Juden anerkennen, statt sie als potenzielle Konvertiten zu betrachten, und drängte darauf, das Konzil solle Antisemitismus als eine mit dem Katholizismus unvereinbare Sünde brandmarken. Er schlug vier Punkte vor: die Verwerfung des Gottesmordsvorwurfs; das Ende missionarischer Aktivitäten; die Hinführung von Christ:innen zum jüdischen religiösen Leben; die Errichtung einer kirchlichen Kommission, die den Vorurteilen ein Ende setzen und die Beziehungen zwischen Jüdinnen/Juden und Christ:innen pflegen sollte.
Kardinal Bea unternahm im März 1963 eine wichtige Reise in die USA, nur zwei Monate, nachdem mein Vater seinen außergewöhnlichen Vortrag über »Religion und Rasse« bei einer Konferenz in Chicago gehalten hatte, wo er zum ersten Mal Martin Luther King Jr. traf. Mein Vater leitete eine Versammlung von Rabbinern und jüdischen Führungspersönlichkeiten im Büro des American Jewish Committee, die mit Kardinal Bea zusammentraf. Worüber wurde diskutiert? Kardinal Bea schrieb: »Als Antwort auf Fragen, die für das Programm formuliert worden waren, klärte ich zunächst vom exegetischen Standpunkt aus die Frage der jüdischen Verantwortung für den Tod Jesu, ebenso die Bedeutung der Zerstreuung des auserwählten Volkes unter die Nationen, indem ich, wie schon Paulus, jeder Vorstellung eine Absage erteilte, als habe Gott sein eigenes Volk verworfen oder sei soweit gegangen, es zu verfluchen.«11
Am Abend fand ein offizielles Dinner zu Ehren von Kardinal Bea im Plaza Hotel/New York statt, bei dem das American Jewish Committee der Gastgeber war.12 Bei diesem Dinner, an dem führende Religionsvertreter der USA sowie Sithu U Thant, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, teilnahmen, richtete mein Vater an den Kardinal die folgenden Worte: »Was wird uns retten? Gott und unsere Fähigkeit, dem Glauben jedes anderen mit Ehrfurcht zu begegnen, dem Einsatz jedes anderen … Das ist die Agonie der Geschichte: Bigotterie, das Fehlen der Ehrfurcht gegenüber dem Glauben jedes anderen. Wir müssen auf der Loyalität zum einzigartigen Schatz unserer eigenen Tradition bestehen und gleichzeitig anerkennen, dass in diesem Äon religiöse Vielfalt genauso dem Willen Gottes entsprechen kann.«13
Ich nehme den Geist dieser Worte in denen von Papst Johannes Paul II. wahr, als er die Hauptsynagoge in Rom am 13. April 1986 besuchte und dabei die einmalige Verbindung zwischen Katholiken und Juden ansprach: »Die jüdische Religion ist uns nicht ›fremd‹, sondern auf eine bestimmte Weise ein Bestandteil unserer Religion.«
Für meinen Vater war bei Treffen von Jüdinnen/ Juden und Christ:innen die wichtigste Frage: »Wie soll ich mich spirituell auf sie beziehen?« Schließlich schrieb mein Vater, wir könnten uns zwar nach Frieden sehnen, aber »Frieden unter den Menschen hängt von einer Beziehung der Achtung gegeneinander ab … Achtung für unsere Freiheit. Gott ist im Leben des Menschen involviert, jedes einzelnen.«14
Es kann in Glaubensfragen keinen Zwang geben, wie Papst Johannes XXIII. in der Enzyklika Pacem in Terris formulierte. Jedes menschliche Wesen hat das Recht, Gott gemäß dem zu verehren, was ein aufrechtes Gewissen fordert. Das Ökumenische Konzil solle die Integrität und den bleibenden Wert der Juden und des Judentums anerkennen und »Juden als Juden« akzeptieren, schrieb er Anfang 1964 an Kardinal Bea.
Können sich theologische Traditionen verändern?
Wie Kardinal Bea erstmals in seinem Buch über die göttliche Inspiration in den 30er Jahren und in vielen darauf folgenden Artikeln und Beiträgen zu Lexika schrieb, gilt das offenbarte Wort Gottes immer, »ohne Hinzufügungen und ohne Auslassungen«; aber die Kirche »erkennt einen legitimen Fortschritt in Bezug auf das Dogma an«, nicht nur allein durch menschliches Tun, sondern, mit Hilfe des Geistes der Wahrheit.15 Gott wird seinem Bund nicht untreu.
In einer Formulierung, die wie ein Kommentar zu Röm 11,29 klingt (»Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt«) ergänzt mein Vater, keine Religion sei endgültig: »Kein Wort ist Gottes letztes Wort, kein Wort ist Gottes endgültiges Wort.« Mehr noch: Wahrheit ist nicht exklusiv – weil sie nie ausgedrückt werden kann. Gott spricht in menschlicher Sprache, dibra Torah k’lschon bnai adam. Was macht das Wort Gottes aus? Ist die Sprache der Schrift Gottes eigene Sprache oder hat Gott auf die Grenzen menschlicher Wesen Rücksicht genommen und in Worten gesprochen, die wir verstehen können?
Kardinal Bea schreibt: »Die Tradition ist im lebendigen Lehramt der gegenwärtigen Kirche zu finden, das auf korrekten Grundlagen beruht«16, unter der Leitung des Heiligen Geistes von der Zeit der Apostel bis heute. Genau so wird hervorgehoben, dass Gottes Offenbarung von den Menschen geformt wird, denen diese Offenbarung anvertraut ist, entweder unter Leitung des Lehramts oder, jüdisch gesprochen, durch die rabbinische Tradition unter der Leitung des Heiligen Geistes, die Schekinah, die göttliche Gegenwart: Das bildet einen gemeinsamen Kern, den mein Vater in seinem eigenen Schaffen und in dem von Kardinal Bea wahrnahm.
Der viel gelesene hebräische Text Schnei Luhot Haberiz aus dem 17. Jahrhundert, verfasst von Isaiah Horowitz (1565 –1630), kommentiert einen Konflikt zwischen zwei Formulierungen in der Liturgie: »Er gab uns seine Torah der Wahrheit« (Vergangenheitsform) und »Er gibt uns die Torah« (Gegenwartsform), vgl. Dtn 5,22. Horowitz schreibt: »In Wahrheit hat Gott die Torah schon gegeben, aber gibt immer noch die Torah und hört damit nicht auf.«17
Der Apter Rav (gest. 1825), der große Vorläufer meines Vaters, schrieb: Ein Jude müsse »sich immer, in jedem Augenblick so betrachten, als ob er am Berg Sinai stünde, um die Torah zu empfangen … Jeden Tag gibt Gott dem Volk Israel die Torah … So wird es eine Haltung von Ehrerbietung und Ehrfurcht erreichen, wie es der Fall war, als die Torah in Furcht und Zittern gegeben wurde.«18
Mein Vater schreibt über die Offenbarung in seinem Buch »God in Search of Man«: »Der Prophet ist nicht passiver Empfänger der Offenbarung, kein Aufnahmegerät, das ohne die Beteiligung von Herz und Willen in Gang gesetzt wird … Er ist ein aktiver Partner des Ereignisses.«19 Wie sieht das Bewusstsein des Propheten aus? Darum ging es in der Dissertation meines Vaters.
So gesehen war mein Vater offen für Veränderung. Wir können nicht alle auf gleiche Weise religiös sein, davon war er überzeugt; es scheint der Wille Gottes zu sein, dass wir unseren Glauben auf verschiedene Arten ausdrücken. Selbst im Judentum befürwortete er einen Pluralismus. Er zitiert den Kotzker Rebbe, der betonte, unser Judentum müsse im Blick auf uns selbst authentisch sein; mein Vater schreibt, es wäre »spirituelles Plagiieren«, den Glauben unserer Großväter zu imitieren. Tatsächlich wurde ich zwar in einer gläubigen Familie schomer mitzvot, in Erfüllung der Gebote, erzogen, dennoch sprach sich mein Vater dafür aus, dass ich Rabbinerin werden sollte und gestaltete die Bat Mitzvah, wie ich sie wollte. Er schrieb, der Prophet sei »ein Bilderstürmer, der das offensichtlich Heilige, Verehrte und Ehrfurchtgebietende herausfordert. [Der Prophet] entlarvt für sicher gehaltene Glaubenssätze und mit höchster Heiligkeit umgebene Institutionen als skandalöse Ansprüche.«20
Fazit
Es gibt im Talmud eine Diskussion zweier Rabbiner, Rav und Schmuel, darüber, ob die Welt um Moses willen geschaffen worden sei, damit er die Torah empfangen konnte, oder um Davids willen, damit er Hymnen und Psalmen zum Lob Gottes singen konnte.
Die Antwort lautet natürlich, die Welt sei sowohl für die Schrift wie für die Psalmen erschaffen worden. Wir könnten eine ähnliche Frage bezüglich der Ziele von theologischer Gelehrsamkeit oder sogar im Blick auf den Nutzen eines Vortrags stellen: Werden wir Gelehrte, um die Schrift, also die Ergebnisse unserer Forschung, zu empfangen und weiterzugeben, oder werden wir Gelehrte, um Psalmen zu singen, also uns und andere dazu zu inspirieren, mit dem Wunder in Einklang zu kommen, das der Anfang des Glaubens ist?
Mose sagt in Deuteronomium 32,1: »Hört zu, ihr Himmel, ich will reden, die Erde lausche meinen Worten.« (Haazinu haschmayim v’adabeira; v’tiscma ha’aretz imrei fi) Nach der Erklärung der Rabbiner stand Mose dabei im Himmel und sprach sowohl zum Himmel wie zur Erde.
Wir sollten uns daran erinnern, dass der Dialog nicht nur zwischen uns stattfindet; Gott ist gegenwärtig und hört zu. Möge unser Dialog voller Psalmen sein und zum Gebet werden.
ANMERKUNGEN
1 Der vorliegende Beitrag wurde von Dr. Ulrich Ruh ins Deutsche übersetzt.
2 Butler, Judith (1993): Bodies that matter, New York, p. 224.
3 Furnai, Joshua (2016): Abraham Joshua Heschel and Nostra Aetate: Shaping the Catholic Reconsideration of Judaism during Vatican II, in: Religions 7, Vol. 70, p. 5.
4 Heschel, Susannah (2018): The Aryan Jesus. Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany, Princeton.
5 Persönlicher Brief an Abraham Joshuah Heschel.
6 Heschel, Abraham Joshuah (1996): Moral Grandeur and Spiritual Audacity (= MGSA). Essays, hg. v. Susannah Heschel, New York, p. 297.
7 Zitate ohne Nachweis hier und im Folgenden: persönliche Gespräche.
8 Lechem Shamayim zu 4,11: Der Kommentar wurde 1748 verfasst und 1751 gedruckt, siehe: Schacter, Jacob (1988): Jacob Emden – Life and Major Works, Ann Arbor, Mich., p. 559.
9 Schacter, Jacob (2012): Rabbi Jacob Emden. Sabbatianism and Frankism, in: New Perspectives on Jewish-Christian Relations, Vol. 33, pp. 359–396, 364; Schacter, Jacob (1988): Jacob Emden – Life, p. 735, footnote 120: »Beim Kommentieren der Aussage in der Miscna, ›Jede Versammlung, die um des Himmelreichs willen stattfindet, wird eine langfristige Wirkung haben‹ (ebd., IV, 14) unternahm Emden eine sehr lange und erstaunliche Diskussion der positiven Rollen von Christentum wie Islam in der Geschichte.«
10 Heschel, Abraham Joshua (1955): God in Search of Man, New York (deutschsprachige Ausgabe: Heschel, Abraham Joshua (52000): Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums, Neukirchen-Vluyn/Berlin).
11 Schmidt, Stephjan (1992): Augustin Bea. The Cardinal of Unity. New York, p. 427.
12 Unter den Teilnehmern waren Rabbiner, die die drei Hauptströmungen des amerikanischen Judentums repräsentierten: Rabbiner Louis Finkelstein (Konservative), Rabbiner Joseph Lookstein (Orthodoxe), Rabbiner Albert Mina (Reformjudentum) und Rabbimer Julius Mark (Reformjudentum).
13 Heschel, Susannah (2018): Out of the Mystery Comes the Bond: The Role of Rabbi Abraham Joshua Heschel in Shaping Nostra Aetate, in: Righting Relations after the Holocaust and Vatican II., Essays in Honor of John Pawlikowski, hg. v. Elena G. Procario-Foley; Robert A. Cathey. New Jersey, pp. 199–225: 214.
14 Heschel, Abraham Joshuah (1996): What Ecumenism Is, in: ders., Moral Grandeur, pp. 286 –289: 288.
15 Schmidt, Stephjan (1992): Augustin Bea, pp. 192f.
16 Heschel, Susannah (2018): Out of the Mystery, pp. 199 –225: 206.
17 Sommer, Benjamin (22015): Revelation and Authority. Sinai in Scripture and Tradition. New Haven, p. 206.
18 Ebd., pp. 204f.
19 Heschel, Abraham Joshua (1955): God in Search of Man, New York, p. 259 –260; vgl. auch Heschel, Abraham Joshua (1963): The Prophets, New York, pp. 624– 625.
20 Heschel, Abraham Joshua (1963), The Prophets, p. 12.
Die Autorin
*****
 ... lehrt Jüdische Studien am Dartmouth College, New Hampshire (USA). Sie lehrte als Gastprofessorin an Universitäten in Kapstadt, Princeton, Berlin, Hamburg und hat zahlreiche international renommierte Wissenschaftspreise sowie Ehrendoktorwürden an Universitäten weltweit erhalten. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf jüdischem und protestantischem Denken im 19. und 20. Jahrhundert, einschließlich der Geschichte der Bibelwissenschaft, der jüdischen Islamwissenschaft und der Geschichte des Antisemitismus. 2008 erschien als Summe ihrer Forschungen zum "Entjudungsinstitut": „The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany“. Weitere Monografien sind u.a.: „Der jüdische Jesus und das Christentum: Abraham Geigers Herausforderung an die christliche Theologie“ (2001) und „Jüdischer Islam: Islam und jüdisch-deutsche Selbstbestimmung“ (2018). Aktuell schreibt sie an einer Geschichte der europäisch-jüdischen Gelehrsamkeit zum Islam.
... lehrt Jüdische Studien am Dartmouth College, New Hampshire (USA). Sie lehrte als Gastprofessorin an Universitäten in Kapstadt, Princeton, Berlin, Hamburg und hat zahlreiche international renommierte Wissenschaftspreise sowie Ehrendoktorwürden an Universitäten weltweit erhalten. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf jüdischem und protestantischem Denken im 19. und 20. Jahrhundert, einschließlich der Geschichte der Bibelwissenschaft, der jüdischen Islamwissenschaft und der Geschichte des Antisemitismus. 2008 erschien als Summe ihrer Forschungen zum "Entjudungsinstitut": „The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany“. Weitere Monografien sind u.a.: „Der jüdische Jesus und das Christentum: Abraham Geigers Herausforderung an die christliche Theologie“ (2001) und „Jüdischer Islam: Islam und jüdisch-deutsche Selbstbestimmung“ (2018). Aktuell schreibt sie an einer Geschichte der europäisch-jüdischen Gelehrsamkeit zum Islam.
Kontakt zu COMPASS:
redaktion@compass-infodienst.de

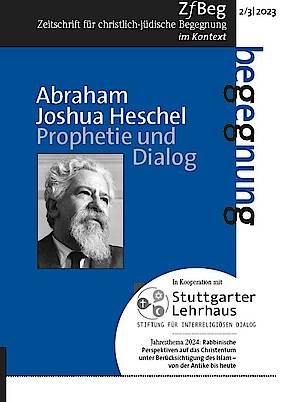 Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung
Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung