ONLINE-EXTRA Nr. 360
© 2025 Copyright bei Autor und Verlag
80 Jahre nach der Befreiung der letzten Überlebenden von Auschwitz sind wir seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Massakers der Hamas an israelischen Bürgern, weltweit mit Antisemitismus und Israelfeindlichkeit in einem Maß konfrontiert, als habe es Auschwitz nie gegeben. „Wir dürfen niemals vergessen, doch Erinnern allein reicht nicht“, mahnt die 103-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer – und forderte aktiven Widerstand gegen Hass und Intoleranz. Erinnerung darf nicht folgenlos bleiben, ansonsten sie zu einer billigen Sentimentalität verkommt. Friedländer hat recht: Erinnerung muss vielmehr zu aktivem Widerstand gegen Hass und Toleranz führen.
Aktiven Widerstand gegen Hass und Toleranz, den haben auch mutige Männer und Frauen während des Dritten Reichs geleistet - und riskierten dabei ihr Leben. So auch 651 Deutsche, die jüdische Mitbürger vor Verfolgung und Ermordung gerettet haben und dafür nach dem Krieg von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wurden. Der bekannteste ist Oskar Schindler. Das Schicksal der meisten anderen Retter und ihrer Schützlinge ist dagegen bis heute einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, obwohl ihre Geschichten häufig so waghalsig und dramatisch waren, dass es kaum vorstellbar ist. Viel zu wenig ist von diesen "unbesungenen Helden" die Rede, viel zu wenig weiß man über sie, viel zu wenig erinnert man ihrer, wo doch gerade die Erinnerung an diese mutigen Menschen ein so wichtiges Vorbild für uns und nachfolgende Generationen wäre!
In einer Pionierleistung hat der Autor Frank Littek erstmals alle diese deutschen 651 "Gerechte unter den Völkern" und ihre Rettungstat in Kurzportraits in seinem Buch "Retter in dunkler Zeit. Die umfassende Übersicht über deutsche Gerechte unter den Völkern" zusammengetragen (nähere Angaben siehe in der Anzeige weiter unten). COMPASS freut sich außerordentlich, Ihnen nachfolgend in diesem ONLINE-EXTRA Nr. 360 die Einleitung Litteks sowie acht exemplarische Beispiele aus seinem Buch präsentieren zu dürfen. Und COMPASS dankt dem Autor und seinem Verlag herzlichst für die Genehmigung zur Wiedergabe dieser Textauszüge.
Online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 360
EINLEITUNG
Im April 1967 startete ein Lehrer an einer Schule in Kalifornien ein Experiment, das später unter dem Namen „The Third Wave“ weltbekannt werden sollte. Er führte bei seinen drei Geschichtsklassen mit 90 Schülern Regeln, Verhaltensnormen und Einschränkungen ein, die den Vorgaben diktatorischer Systeme ähnelten. Er propagierte Stolz und Disziplin, drillte die Schüler körperlich, führte einen speziellen Gruß mit nach oben geführter Hand in Wellenform ein und vermittelte ihnen sehr eindringlich die Vorteile des Gemeinschaftsgefühls. Die Schüler erhielten Mitgliedskarten und wurden angewiesen, vertrauenswürdige Freunde für die neue Bewegung zu gewinnen. Gleichzeitig sollten sie Mitglieder, die sich nicht an die Regeln hielten, denunzieren, was in der Folge auch geschah. Er wollte testen, wie bereitwillig die Schüler – denen nicht klar war, dass sie Teil eines Experiments waren – mitmachten. Das Projekt entwickelte sich so erschreckend, dass es nach fünf Tagen abgebrochen werden musste, weil negative Folgen für die Schüler befürchtet wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die neue Bewegung bereits 200 Mitglieder. Das Geschehen wurde 1981 unter dem Titel „Die Welle“ verfilmt.
Es ist nicht der einzige verstörende Beleg dafür, wie leicht Menschen sich für ein diktatorisches System benutzen lassen. Bereits 1961 war in den USA das Milgram-Experiment durchgeführt worden. Dabei sollten Probanden, denen man die Rolle von Lehrern gegeben hatte, die Lernleistung von Testschülern verbessern, indem sie diesen bei falschen Antworten vermeintliche Stromstöße verabreichten. Das Verfahren wurde als wissenschaftlich wichtig deklariert und die Stromstöße im Laufe des Experiments so gesteigert, dass die Testschüler ohrenbetäubend schrien und schließlich bei weiterer Steigerung Stille eintrat. Ergebnis der Tests: Die Mehrheit der Probanden führte die Tests trotz der lauten Schreie der vermeintlichen Schüler – in Wirklichkeit Schauspieler – bis zur höchsten Stufe durch, nur ein kleinerer Teil brach den Versuch ab und weigerte sich, bei der Durchführung weiter mitzumachen.
Andere Experimente zur Konformität menschlichen Verhaltens von Solomon Asch haben gezeigt, dass die meisten Menschen selbst offensichtlich falsche Aussagen als richtig bewerten, wenn sie einem Gruppenzwang ausgesetzt sind.
Was bewegt die Mehrheit der Teilnehmer dazu, sich unter Gruppenzwang so anzupassen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Psychologie. Zu den Ergebnissen gehört, dass die Bereitschaft zum Mitmachen keine Frage der Nationalität zu sein scheint. Interessant ist, dass sich bei dem Wellen-Experiment wie auch der Arbeit von Milgram eine Minderheit widersetzte. Während es bei Milgram immerhin 14 Probanden waren, weigerten sich bei „The Third Wave“ drei Schülerinnen sehr offen. Sie mussten darauf das Klassenzimmer verlassen und wurden in eine Bibliothek eskortiert. Auch beim Konformitätsexperiment von Asch gab es Menschen – hier war es immerhin ein Viertel – die trotz Gruppenzwang unbeeinflusst blieben. Die Konformität nahm aber mit der Gruppenstärke zu. Das Verhalten dieser Menschen, die nicht mitmachten, ist interessant. Es gab sie in allen drei vorgestellten Experimenten – und sie scheinen ungeachtet des sozialen Drucks nach eigenen Grundsätzen gehandelt zu haben.
Nach diesem inneren Kompass handelten auch im Dritten Reich Menschen. Und sie setzten sich dabei einem erheblichen Risiko aus, das aus dem Verlust der Stellung, der Freiheit und sogar des eigenen Lebens und dem von Familienmitgliedern und Freunden bestand. Auf Basis dessen, was sie für richtig und geboten hielten, handelten sie entgegen der vorherrschenden öffentlichen Meinung, der Gesetze sowie der allgegenwärtigen Propaganda und retteten Juden vor der Deportation und der Ermordung.
In den meisten Fällen geschah das, indem die Retter Juden vor dem Zugriff von Gestapo und SS versteckten und mit Lebensmitteln versorgten. Vielfach lebten sie zusammen mit ihren Schützlingen in der eigenen Wohnung, häufig auf sehr beengtem Raum. Versteckt wurden Juden aber auch in Lauben in Kleingartengebieten, in Betrieben, Kellern oder auf Booten.
Einige Retter hatten Freunde, die ähnlich dachten, andere waren gar in ganze Netzwerke eingebunden oder hatten einen christlichen, kommunistischen oder sozialdemokratischen Hintergrund, der sie früh in Distanz zum Nationalsozialismus treten ließ. Sehr viele aber waren allein. Das gilt – um zwei Beispiele zu nennen – für Henny Brunken, eine einfache Frau aus Bremen, die KZ-Häftlinge mit Lebensmitteln versorgte oder für Heinrich Heinen, der im Alleingang von Köln nach Riga fuhr, um seine Verlobte aus dem Ghetto zu befreien. Es gilt auch für die Soldaten der Wehrmacht, die meist in einem kameradschaftlich ganz anders orientierten Umfeld zu Rettern von Juden wurden und teilweise über Jahre dabei nur nach ihren eigenen Wertvorstellungen agierten.
Manchmal blieb ein Jude mehrere Jahre bei seinem Retter, in vielen anderen Fällen gehörte es zur Strategie der Rettung, dass die Unterkunft häufig gewechselt wurde. Und zuweilen machte das auch die Zerstörung von Wohnraum durch Bombenangriffe nötig. Oft kannten sich Retter und Schützlinge schon lange vor der Rettung und sie waren schon zuvor befreundet. In gar nicht so seltenen Fällen aber waren sich beide Seiten vorher unbekannt. Dann nahmen Retter Menschen in ihre Wohnungen auf, die sie nie zuvor gesehen hatten.
Darüber hinaus gab es zahlreiche Fälle, in denen nichtjüdische Deutsche ihren jüdischen Mitbürgern halfen, indem sie zum Beispiel Dokumente fälschten, sie durch eine Beschäftigung als Zwangsarbeiter vor der Deportation bewahrten, sie aus dem Gefängnis holten, ihnen zur Flucht verhalfen oder sie ins Ausland brachten.
Wer die Portraits der Retter in diesem Buch liest, ist immer wieder erstaunt über die Umstände vieler Geschichten und betroffen darüber, was Menschen anderen Menschen antun. Bei allen Rettungstaten beeindrucken Mut und Hilfsbereitschaft der Gerechten – und immer wieder auch, wie findig und manchmal sogar frech zuweilen Retter und Schützlinge waren. Da versteckten Retter Juden Wand an Wand mit einer Gestapostation, direkt über dem Polizeirevier, oder ein Stromkabel für die Versorgung der Versteckten wurde aus der nahen NSDAP-Kreisleitung abgezweigt.
Auf der anderen Seite schockiert die Tragik in vielen Geschichten und die Gefahren, denen Retter und Juden ausgesetzt waren. Dazu gehörte zum Beispiel das Risiko, auf Greifer wie Rolf Isaaksohn oder Stella Goldschlag zu treffen. Greifer waren Juden, die andere Juden an die Gestapo verrieten und dafür von staatlicher Seite bevorzugt behandelt – und vor allem nicht deportiert wurden.
Weit größer als die Gefahr, einem Greifer zu begegnen, war das Risiko der Denunziation. Welches Ausmaß diese hatte, ist erschreckend und wirft kein gutes Bild auf die deutsche Bevölkerung in dieser Zeit, wie die Auswertung von Polizeiakten aus dem bayerischen Unterfranken ergeben hat. Bis auf wenige Ausnahmen wurden entsprechende Unterlagen im ganzen Deutschen Reich vernichtet. Die Akten aus Unterfranken sind eine der wenigen Ausnahmen und deshalb ein wichtiges Zeugnis der Zeit. Sie zeigen, dass der Großteil der Ermittlungen der Gestapo im Bereich „Rassenschande“ und „judenfreundliches Verhalten“ durch Hinweise aus der Bevölkerung angestoßen wurde. In den meisten Fällen wurde die Gestapo nicht tätig, weil ihre Ermittler so clever und wachsam waren – sondern weil die deutschen Bürger so eifrig ihre Nachbarn zur Anzeige brachten. Und dabei war Unterfranken sogar noch eine Region, in der es 1933 prozentual vergleichsweise wenig NSDAP-Mitgliedern gab. Das Wahlergebnis für diese Partei war das schlechteste in ganz Bayern.
Bei der Lektüre der Geschichten entsteht mit der Zeit ein sich immer mehr vertiefendes Bild der damaligen Ereignisse. Speziell in Berlin oder auch Württemberg lernt der Leser Teile der Rettungsnetzwerke kennen, wenn Schutzbedürftige nach Denunziation von einem Haus in ein anderes wechseln mussten, Fluchtwege, die Arbeitsweise von Gestapo und SS und den historischen Hintergrund, der sich wie ein Puzzle aus den Mosaiksteinen der einzelnen Portraits zusammensetzt.
Dank der Hilfe der Gerechten konnten Juden der Ermordung entgehen. Manche gerieten trotzdem in die Fänge von Gestapo und SS. Auch Retter starben, wurden inhaftiert, in Lager eingeliefert und bei einigen verliert sich die Spur im Krieg, oder sie wurden nach dem Krieg von der deutschen Bevölkerung angefeindet, bedroht oder ermordet. Sehr viele ihrer Geschichten aber gingen gut aus – für die Retter und ihre Schützlinge. Häufig dauerte es lange, bis nach dem Tod der Betreffenden, bis die Öffentlichkeit ihr Wirken würdigte. Das leistet in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sie hat den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ ins Leben gerufen, mit dem Menschen ausgezeichnet werden, die unter eigenem Risiko Juden in der Zeit von Verfolgung und Holocaust gerettet haben. 651 Deutsche wurden bisher ausgezeichnet. Jeder von ihnen rettete Juden. Jeder von ihnen setzte aber auch ein Zeichen des Anstands in einem barbarischen Staat, zeigte, dass es immer auch ein anderes, besseres Deutschland gegeben hat. Es lohnt, darauf aufzubauen. Das gilt umso mehr in einem Land, das nach wie vor Schwierigkeiten im Umgang mit der eigenen jüngeren Geschichte hat. Jeder Retter ist damit auch ein positiver Bezugspunkt in einer ansonsten dunklen Zeit der deutschen Geschichte. Entsprechend stände es der Bundesrepublik gut an, die deutschen Retter sehr viel stärker zu ehren, als das bisher geschehen ist. Eine Auszeichnung, vergleichbar dem israelischen Titel des Gerechten unter den Völkern, wäre eine gute Idee. Eine solche gibt es bisher nicht. Dafür aber bestehen andere positive Beispiele für die Würdigung einiger dieser Frauen und Männer: Dazu gehört die Gedenkstätte „Stille Helden“, die Menschen gedenkt, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Juden beistanden. Im schleswig-holsteinischen Appen wurde das zentrale Lehrgebäude einer Kaserne der Luftwaffe nach dem Feldwebel Karl Laabs benannt. Er rettete Juden. In anderen deutschen Orten sind zum Beispiel Straßen nach Rettern benannt, haben Museen das Thema aufgegriffen und einige Rettergeschichten waren nicht nur Thema in Schulklassen, sondern wurden sogar erst im Zuge von Schulprojekten entdeckt und erarbeitet. Es ist zu wünschen, dass es in Zukunft mehr dieser Beispiele gibt. Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten.
Inhalt sind ausdrücklich nur die Menschen, die von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt wurden. Rettungswiderstand wird zuweilen weiter gefasst. Das ist legitim – aber nicht Thema dieses Buches. Es wurde zu guter Letzt ausdrücklich nicht als wissenschaftliches Fachwerk für Spezialisten geschrieben, sondern als populär geschriebener Text, der eine möglichst breite Leserschaft erreichen und mit den Gerechten bekannt machen möge.
651 Deutsche retteten im Dritten Reich jüdische Mitbürger vor der Ermordung – und riskierten dabei das eigene Leben. Sie wurden nach dem Krieg von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" geehrt. Dabei gab es viele Wege der Hilfe. Sie reichten vom Verstecken in der eigenen Wohnung über das Fälschen von Papieren bis zur direkten Konfrontation mit der SS mit vorgehaltener Waffe. Was bewog diese Menschen zum Handeln? Aufschluss darüber geben im ersten Teil 100 ausgewählte Portraits der Retter. Im zweiten Teil werden erstmals alle 651 Gerechten und ihre Rettungstat in Kurzportraits erzählt. Ein Rahmen, der den historischen Hintergrund und die Arbeit von Yad Vashem erläutert, rundet das Buch ab.
AUSZÜGE / GERECHTE UNTER DEN VÖLKERN
Hans Feyerabend
Am 1. Februar 1945 wurden am Strand von Palmnicken, dem heutigen Jantarny, an der Ostsee 3.000 Juden ermordet. Während sich der Bürgermeister des Dorfes dabei als besonders eifriger Helfer der SS zeigte, versuchte ein Mann die Menschen zu retten: Hans Feyerabend. Auch wenn sein Bemühen letztlich tragisch scheiterte, erkannte ihn Yad Vashem am 18. Juni 2013 als Gerechten unter den Völkern an. Feyerabend hatte eine militärischen Vergangenheit. Im Ersten Weltkrieg diente er als Artillerieoffizier. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Gutsverwalter in Ostpreußen nordwestlich von Königsberg, wobei er in Palmnicken lebte. Das Dorf befand sich direkt an der ostpreußischen Ostseeküste. Als gegen Kriegsende in Deutschland der so genannte Volkssturm aufgestellt wurde, ernannten die Behörden Feyerabend zum Kommandeur der örtlichen Volkssturmeinheit der Region. Der Volkssturm bestand aus Jugendlichen und älteren Männern, die aufgrund ihres Alters nicht zur regulären Wehrmacht eingezogen wurden. Sie sollten sich als „letztes Aufgebot“ den anrückenden alliierten Truppen entgegenstellen. Während Feyerabend sein neues Kommando innehatte, waren überall in Deutschland Juden in so genannten Todesmärschen unterwegs, mit denen die KZ evakuiert wurden. Auch in Ostpreußen gab es Lager. Häftlinge aus den Außenlagern des KZ Stutthof marschierten im Januar 1945 entlang der Ostseeküste. Es war eiskalt.
Unter den Häftlingen waren Tausende jüdischer Frauen. Sie hatten am Bau von Festungsanlagen im Königsberger Gebiet gearbeitet, nachdem sie zuvor aus Auschwitz gekommen waren. Auf ihrem weiteren Weg mussten sie sechs Tage in einer verlassenen Fabrik in Königsberg ausharren, bevor der Marsch nach Palmnicken an der Ostseeküste weiterging. Hier kommandierte Hans Feyerabend den Volkssturm. Er musste mit dem Bürgermeister des Ortes, Kurt Friedrichs, zusammenarbeiten. In Palmnicken brachte die SS die Häftlinge, es waren 3.000 Menschen, in eine Bernsteinmine. Der Stollen sollte verschlossen und die Hälftlinge sich selbst überlassen werden, was natürlich zu deren Tod geführt hätte. Als Hans Feyerabend davon erfuhr, setzte er sich für die Hälftlinge ein und forderte ihre Freilassung, was natürlich zu einem Konflikt mit Fritz Weber, dem verantwortlichen SS-Offizier, führte. Durch das Kommando über den Volkssturm verfügte Feyerabend über beachtliche militärische Fähigkeiten. Im Ergebnis konnte die SS den Mord im Bergwerksstollen nicht durchführen. Weber war klar, dass Feyerabend aus dem Ort verschwinden musste, wollte er die Juden umbringen. Dazu sprach er sich mit Bürgermeister Friedrichs ab. Beide Männer entwickelten einen Plan, um Feyerabend loszuwerden. Dabei teilten sie dem Volkssturmkommandanten mit, dass er dringend als Verstärkung einer Wehrmachtseinheit in Kumehnen, dem heutigen Kumatschowo, benötigt werde. Der Ort liegt rund 20 Kilometer östlich. Feyerabend zog mit 100 Mann seiner Einheit los, um der Wehrmacht zu helfen. Am 30. Januar 1945 traf er mit seinen Männern in Kumehnen ein – und musste feststellen, dass die Soldaten dort mit keiner Verstärkung durch ihn gerechnet hatten und auch keine angefordert hatten. In der Folge nahm sich Feyerabend selbst das Leben. Nachdem er sich der SS nicht mehr in den Weg stellen konnte, führte diese in der Nacht zum 1. Februar die 3.000 Juden zum Strand. Hitlerjungen unterstützten die SS dabei. Am Strand wurden die Juden erschossen. Kurt Friedrichs, der Bürgermeister, tat sich dabei besonders hervor. Wie Martin Bergau, der als Hitlerjunge dabei war, sich später erinnerte, forderte er die Jungen auf, in den Wäldern nach versteckten Juden zu suchen und Dorfbewohner zu fragen, ob sie Juden gesehen hätten, denen die Flucht gelungen sei. 18 jüdische Menschen überlebten trotzdem. Viele Dorfbewohner beteiligten sich an der Ermordung und Verfolgung der Juden, die fliehen konnten. Einige nahmen aber auch die 18 Überlebenden des Massakers bis zum Eintreffen der Roten Armee auf.
Albert Battel und Max Liedtke
Es gibt eine ganze Reihe von Rettern, die der Wehrmacht angehörten. So ist das auch bei den Portraits von Albert Battel und Max Liedtke. Ihre Geschichte ist darüber hinaus besonders, weil sich beide Männer als Offiziere unter Einbeziehung der ihnen unterstehenden Soldaten mit Waffeneinsatz der SS entgegenstellten, als diese Juden aus einem Ghetto deportieren wollte. Dabei wäre es beinahe zu einem bewaffneten Konflikt zwischen Wehrmacht und SS gekommen. Albert Battel war Rechtsanwalt in Breslau und Reserveoffizier. Schon vor dem Krieg fiel er den Behörden durch „judenfreundliches Verhalten“ auf. Er hatte zum Beispiel einem jüdischen Kollegen einen Kredit gegeben. In seiner Funktion als Reserveoffizier wurde er im Alter von 51 Jahren als Adjutant des örtlichen Militärkommandanten, Major Max Liedtke, im polnischen Przemysl stationiert. Sein militärischer Rang war der eines Oberleutnants. Auch hier fiel Battel den Behörden früh auf, als er dem Vorsitzenden des Judenrats, Ignaz Duldig, vor Ort mit Handschlag begrüßte. Battel kannte Duldig noch aus Wien, wo er während der Studienjahre mit ihm befreundet gewesen war. Sein Vorgesetzter, Max Liedtke, war im Juli 1939 zur Wehrmacht eingezogen worden und nahm an den Kampfhandlungen bei der Eroberung Polens im September 1939 teil. Anschließend wurde er der Militärverwaltung zugeteilt, wo er zunächst in Belgien, dann in Griechenland eingesetzt wurde. Im Juli 1942 erhielt er die Aufgabe des Militärkommandeurs von Przemysl, wo er zusammen mit Battel die Schlüsselrolle in einer einzigartigen bewaffneten Konfrontation zwischen Wehrmacht auf der einen Seite und SS und Gestapo auf der anderen innehatte. Wie in vielen anderen Städten im europäischen Osten, waren auch in Przemysl die Juden in einem Ghetto zusammengefasst. Derartige Ghettos waren erste Schritte auf dem Weg in die Vernichtung. Viele jüdische Menschen starben bereits an Hunger und Entkräftung in den Ghettos. Der Weg aus dem Ghetto heraus führte für die meisten Juden in den Tod – in den Jahren 1941 und 1942 häufig in Form von Erschießungen, ab 1942 dann in die Vernichtungslager wie Auschwitz. Am 26. Juli 1942 hatten Battel und Liedtke gerade erst ihren Dienst angetreten, als die SS die Juden aus dem Ghetto in Przemysl deportieren wollte. In einer sofort einberufenen Stabsbesprechung der Wehrmachtsoffiziere forderte Battel, die Brücke über den Fluss San, den einzigen Zugang zum Ghetto, mit Wehrmachtssoldaten zu blockieren und dieses rechtlich mit einem vorhandenen „Belagerungszustand“ zu begründen. Lag ein Belagerungszustand vor, hatte die Wehrmacht an einem Ort die oberste Entscheidungsbefugnis. Liedtke war einverstanden und schloss sich Battels Sichtweise an. Auf Bedenken reagierte Liedtke mit dem überlieferten Satz: „Das Schlimmste, was sie mit uns machen können, ist, dass sie uns erschießen.“ Der Beschluss wurde sofort in die Tat umgesetzt. Das Kommando vor Ort auf der Brücke übernahm Albert Battel. Als die SS anmarschierte, blockierte er wie besprochen mit seinen Männern die Brücke und ließ auf die SS-Männer anlegen. Es entstand eine Pattsituation, die bis in den Nachmittag andauerte. Battel nutzte die Situation und ließ seine Soldaten mit Lastwagen in das Ghetto fahren, um rund 100 Juden und ihre Familien in die Baracken der Militärkommandantur zu bringen und sie dem Schutz der Wehrmacht zu unterstellen. Sehr wahrscheinlich ging Liedtke davon aus, durch das militärische Oberkommando in Polen Rückendeckung zu erhalten. Dem war aber nicht so. Noch am selben Tag erhielt er den Befehl, den „Belagerungszustand“ aufzuheben. Am nächsten Tag konnte die SS in das Ghetto eindringen. Rund 8.000 jüdische Menschen wurden in das Vernichtungslager Belzec transportiert. Das weitere Schicksal der beiden Männer: Liedtke wurde am 30. September seines Postens als Militärkommandant enthoben und der Kommandantur der 1. Panzerarmee im Kaukasus zugeteilt. Er machte den Rückzug der Wehrmacht mit, landete in Danzig und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. 1955 starb er in einem Kriegsgefangenenlager im Ural. Am 24. Juni 1993 erkannte Yad Vashem ihn als Gerechten unter den Völkern an. Er ist der höchste deutsche Offizier, dem diese Ehre zuteil wurde.
Albert Battel wurde 1944 aus dem aktiven Dienst bei der Wehrmacht entlassen. Grund war eine Herzkrankheit. Er kehrte nach Breslau zurück, wo er in den Volkssturm eingezogen wurde und in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Nach seiner Freilassung ging er nach Westdeutschland, durfte aber aufgrund des Urteils einer Entnazifizierungskammer nicht wieder als Rechtsanwalt arbeiten. Er starb 1952 in Hattersheim bei Frankfurt. Yad Vashem erkannte ihn am 28. Januar 1981 als Gerechten unter den Völkern an.
Max Maurer
Max Maurer gehört zu den Gerechten, die vermutlich noch kurz vor ihrer Rettungstat nicht geahnt hatten, dass sie einmal Juden retten würden. In Fall von Max Maurer kommt hinzu, dass er als Wachtmeister eine kleine Polizeistation in Ergoldsbach bei Landshut in Bayern kommandierte und damit eigentlich mit der Umsetzung staatlicher Anweisungen betraut war. In dieser Funktion wurden ihm kurz vor Kriegsende, am 27. April 1945, von der SS 13 jüdische Gefangene übergeben, die er ins Gefängnis nach Landshut bringen sollte. Die Häftlinge waren zuvor aus einem Todesmarsch geflohen, der vom Konzentrationslager Buchenwald nach Niederbayern geführt hatte, wobei die SS sie wieder eingefangen hatte. Es war klar, dass ihnen in Landshut die Erschießung drohte. Einer der Gefangenen war Joshua Lusztig, ein Rechtsanwalt aus der Slowakei. Er sprach Maurer an und bat, sie zu verschonen. Der Wachtmeister entschied, den ausgehungerten Gestalten zu helfen – und brachte sie auf den Hof der befreundeten Familie Gandl. Hier versteckten sich die Häftlinge bis zum Einmarsch der US-Amerikaner. Unter den von Maurer Geretteten befanden sich neben Josua Lusztig zwei Jugendliche, Jancsi-John Weiner und Bandi-Andrew Rauchwerk. Von einigen weiteren Geretteten sind die Namen bekannt. Dabei handelt es sich um Majer Lieberman, Moses Kohn und Angel-Moses Ancselovics. Yad Vashem erkannte Max Maurer am 13. Dezember 1995 als Gerechten unter den Völkern an.
Probe-Abonnement
Nahost/Israel, Gedenken und Erinnern, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, multikulturelle Gesellschaft, christlich-jüdischer und interreligiöser Dialog, jüdische Welt. Ergänzt von Rezensionen und Fernseh-Tpps!
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
Henny Brunken
Dass die Unterstützung jüdischer Menschen nicht immer spektakulär sein musste und auch mit geringen Mitteln möglich war, zeigt eindrucksvoll die Geschichte von Henny Brunken. Die Hausfrau lebte in Bremen nicht weit entfernt von der Weser. Ihr Mann war Soldat bei der deutschen Marine und fuhr auf einem U-Boot, während Henny Brunken in Bremen den sechs Monate alten Sohn und die fünfjährige Tochter Erika versorgte. In der Nähe ihres Wohnhauses in der Hastedter Heerstraße waren viele Wohnhäuser durch alliierte Bombenangriffe schwer beschädigt. Henny Brunken konnte sehen, wie Zwangsarbeiter von früh morgens bis spät am Abend an der Beseitigung der Trümmer arbeiteten. Dabei fielen ihr zwei junge Frauen auf. Es waren die siebzehnjährige Eva Kozlowski und ihre Schwester Ella. Die beiden jüdischen Mädchen kamen ursprünglich aus Berlin. Sie taten Frau Brunken so leid, dass sie sich spontan entschloss zu helfen. Sie füllte Milch und Haferflocken in eine Flasche, um sie den Mädchen zu bringen. Wie aber konkret die Flasche zu den Mädchen bringen, ohne dass es auffiel? Dazu steckte die findige Hausfrau die Flasche in eine Wollsocke, hängte sie an den Tretroller der Tochter Erika und schickte das Mädchen auf den Weg zu den beiden jüdischen Schwestern. Die Gabe kam an, wurde nicht entdeckt und die Tochter kam wohlbehalten zurück zur Mutter. Am nächsten Morgen wurde die kleine Erika wieder auf den Weg geschickt. Die Fahrt wiederholte sie von nun an regelmäßig – sie wurde für Ellen und Eva im Januar und Februar 1945 zu einer zusätzlichen Versorgung, auf die sie sich verlassen konnten. Als Eva am 25. Februar ihren 18. Geburtstag hatte, schenkte ihr Henny Brunken ein selbstgemachtes Taschentuch mit ihren Initialen, die sie aufgestickt hatte. Den beiden jüdischen Mädchen gab das Kraft. Nicht nur körperlich in Form der Lebensmittel, sondern auch mental. Die Hilfe stärkte ihren Überlebenswillen und die Gewissheit, dass es unter den Menschen nicht nur Hass und Gewalt, sondern auch Unterstützung und Solidarität gab. Am 28. Februar wurde die Einheit der Zwangsarbeiter, zu der Eva und Ella gehörten, versetzt. Henny Brunken konnte nicht mehr helfen. Unglücklicherweise verstarb am selben Tag Henny Brunkens Mann auf seinem U-Boot – was die Frau aber erst später erfuhr. Die beiden Mädchen, denen sie so treu geholfen hatte, überlebten den Krieg. Sie wanderten später nach Israel aus. 22 Jahren später kamen Henny Brunken und die beiden jüdischen Schwestern wieder in Kontakt. Ella Kozlowski hatte eine Suchanzeige in der Bremer Tageszeitung Weser-Kurier geschaltet. Darauf meldete sich ihre Helferin und es kam zu einem regen Briefwechsel. 1968 besuchte Frau Brunken auf Einladung der Schwestern Israel und im selben Jahr, am 20. September 1968, erkannte Yad Vashem sie als Gerechte unter den Völkern an.
Marie Burde
Eine weitere Gerechte unter den Völkern ist Marie Burde. Sie ist ein Beispiel dafür, dass Menschen zu Rettern wurden, selbst wenn sie am untersten Rand der Gesellschaft lebten und materiell für die eigene Versorgung kaum genug hatten. Burde lebte im Wedding, einem Berliner Arbeiterstadtteil. Ihre Wohnung war nicht mehr als ein dunkles Kellerloch. Sie lebte davon, alte Zeitungen, Lumpen und leere Flaschen zu verkaufen. Trotz ihrer schwierigen Lage zögerte sie nicht einen Augenblick, als im Herbst 1942 drei junge Männer im Alter von 21 und 22 vor ihrer Wohnungstür standen und um Unterkunft und Hilfe baten. Bei den dreien handelte es sich um die Brüder Alfred und Rolf Joseph sowie ihren Freund Arthur Fondanski. Marie Burde nahm sie spontan auf – und erfuhr ihre Geschichte. Am 6. Juni 1942 war Rolf von der Zwangsarbeit nach Hause zurückgekehrt, als er auf der Treppe des Hauses Lärm aus der eigenen Wohnung hörte: Schreie seiner Mutter und eine fremde laute Stimme. Als Schritte auf der Treppe zu hören waren, machte er spontan kehrt und rannte weg – wofür er sich sein Leben lang Vorwürfe machte. Rolf suchte seinen Bruder Alfred, den er bei Freunden fand. Sie stellten fest, dass ihre Eltern abgeholt worden waren. Vater Herrmann Joseph hatte im Ersten Weltkrieg – wie viele Juden – als Soldat für Deutschland gekämpft. In den folgenden Tagen übernachteten die Brüder draußen, ließen sich in der Stadt treiben und sprachen Nachbarn an. Von einem erhielten sie 2.000 Reichsmark, die die Mutter für sie dort deponiert hatte. Sie trafen Alfreds Freund, Arthur Fondanski, der sich in einer vergleichbaren Lage befand. Von nun an schlugen sie sich zu dritt in Berlin durch. Sie übernachteten in Parks, Bahnhöfen sowie nahegelegenen Wäldern und ernährten sich von Lebensmitteln, die sie vom erhaltenen Geld auf den Schwarzmärkten kauften. Als der Herbst kam, wurde ihnen klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie mussten ein Dach über dem Kopf finden. Sie trafen eine Bekannte ihrer Eltern, die zwar nicht selbst helfen wollte, ihnen aber den Hinweis auf eine Frau gab, die möglicherweise helfen würde, da sie dafür bekannt sei, dass sie mit Verfolgten sympathisiere und heimlich Juden helfe. So gelangten die drei zu Marie Burde. Von nun an schliefen sie nachts in Burdes Wohnung auf Zeitungsstapeln, die die Frau zuvor gesammelt hatte. Tagsüber mussten sie die Wohnung verlassen, damit die Nachbarn nicht auf sie aufmerksam wurden. Das Leben für die kleine Gemeinschaft war riskant. Es war immer möglich, dass die jungen Männer auf der Straße von einem Polizisten angehalten wurden – und im Prinzip konnte jeder Passant und vor allem die Nachbarn sie denunzieren, wenn sie Verdächtiges zu sehen glaubten. Alles ging gut bis zum November 1943, als ein Bombenangriff das Haus zerstörte. Marie Burde und ihre drei Schützlinge machten sich auf den Weg nach Schönow, nördlich von Berlin, wo sie ein Grundstück besaß. Bei einer Polizeikontrolle gaben sie schlicht an, dass all ihre Papiere bei dem Bombenangriff verbrannt seien. In Schönow bauten sie aus zusammengesuchten Brettern eine provisorische Unterkunft, während Marie Burde bei den Behörden parallel als ausgebombte Bewohnerin der Stadt eine Ersatzwohnung beantragte – und schließlich auch ein Zimmer bekam. Auch die drei jungen Männer fanden dort wieder einen Schlafplatz. Im August 1944 hatte Alfred Pech bei einer Polizeikontrolle. Er wurde verhaftet und zunächst ins Konzentrationslager Sachsenhausen, dann nach Bergen-Belsen transportiert. Er überlebte – genau wie sein Bruder, den er nach dem Krieg wiedertraf und Arthur Fordanski. Nach dem Krieg halfen sie ihrer Retterin, die in den fünfziger Jahren starb. Die Brüder erfuhren auch vom Schicksal ihrer Eltern. Diese waren zunächst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz transportiert worden, wo sie ermordet wurden. Yad Vashem erkannte Marie Burde am 14. Februar 2012 als Gerechte unter den Völkern an.
Maria und Josef Dinzinger
Im April 1945 stand das Kriegsende kurz bevor. Noch kämpften Verbände der Wehrmacht und SS in Ost und West gegen die alliierten Truppen. Viele Konzentrationslager waren bereits befreit, überall im verbliebenen Reichsgebiet wurden Juden auf Todesmärschen durch das Land getrieben. Viele verloren dabei kurz vor der Rettung noch das Leben, nur wenige hatten auf den Märschen noch die Kraft, ihren Bewachern zu entkommen. Dazu gehörten Yerucham Apfel, ein jüdischer Elektriker aus dem polnischen Mielec, und sein Freund. Am späten Abend liefen sie auf der Flucht durch ein abgelegenes Moorgebiet in Bayern in der Nähe der Gemeinde Parnkofen nahe der Isar. Vor ihnen lag ein Bauernhof, rund zwei Kilometer abseits des Dorfes. Die beiden Männer nahmen allen Mut zusammen und klopften. Als der aufgeschreckte Bauer öffnete, baten sie um eine Übernachtungsmöglichkeit. Bei dem Bauer handelte es sich um Josef Dinzinger, der zusammen mit seiner Frau Maria auf dem Hof lebte. Beiden war sofort klar, wer die abgemagerten Männer in der gestreiften Häftlingskleidung waren. Sie versteckten sie im Kuhstall und versorgten sie mit warmen Decken und Nahrung. Ein Offizier, der sich im Haus aufhielt, und Dinzigers Neffe, der bei der Hitlerjugend war, bekamen den Aufenthalt der Flüchtlinge auch mit. Tage später rückten Wehrmachtstruppen an und quartierten sich auf dem Hof ein, den sie zu ihrem Hauptquartier machten. Für Dinziger war das kein Grund, die beiden Häftlinge fortzuschicken. Im Gegenteil: Er ging ins Dorf, bestach einige Beamte und verschafften seinen beiden Schützlingen falsche Papiere, mit denen er ihre Existenz legalisierte. Yerucham Apfel überlebte den Krieg. Im Jahr 1957 reiste er zurück nach Parnkofen. Während Maria Dinzinger lebte, traf er ihren Mann nicht mehr an. Josef Dinziger war 1948 im Alter von 54 Jahren verstorben. Apfel konnte nicht mehr tun, als an seinem Grab einen Kranz abzulegen. Am 30. November 1966 erkannte Yad Vashem die beiden Helfer als Gerechte unter den Völkern an.
Der Autor
 Frank Littek ist Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet seit rund 40 Jahren als Journalist und Autor. Von ihm sind rund 40 Bücher in renommierten Verlagen erschienen. Das Dritte Reich ist auch Thema seines im April 2024 erschienen Romans „Sechs Tage im Juli“, der das Schicksal von sieben Menschen währen der alliierten Bombenangriffe auf Hamburg erzählt. Vorbild für zwei der Hauptpersonen waren Heinz Droßel und die von ihm gerettete Jüdin Marianne, deren Geschichte auch in „Retter in dunkler Zeit“ erzählt wird.
Frank Littek ist Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet seit rund 40 Jahren als Journalist und Autor. Von ihm sind rund 40 Bücher in renommierten Verlagen erschienen. Das Dritte Reich ist auch Thema seines im April 2024 erschienen Romans „Sechs Tage im Juli“, der das Schicksal von sieben Menschen währen der alliierten Bombenangriffe auf Hamburg erzählt. Vorbild für zwei der Hauptpersonen waren Heinz Droßel und die von ihm gerettete Jüdin Marianne, deren Geschichte auch in „Retter in dunkler Zeit“ erzählt wird.
Kontakt zum Autor und/oder COMPASS:
redaktion@compass-infodienst.de

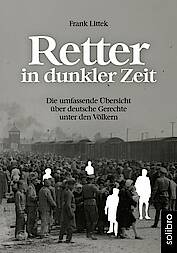 Frank Littek
Frank Littek