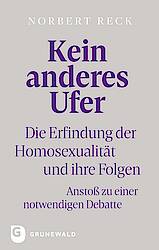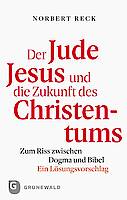ONLINE-EXTRA Nr. 361
© 2025 Copyright beim Autor
Queerfeindliche Straftaten nehmen in Deutschland zu. Das zeigt das jüngste Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA), das Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Herbst 2024 vorstellte. Den Angaben zufolge erfasste die Polizei 2023 insgesamt bundesweit 17.007 Fälle von Hasskriminalität. Mehr als jeder Zehnte dieser Fälle - 1.785 Straftaten - richtete sich im vergangenen Jahr laut BKA gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen. Die Behörden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. In 63 Staaten wird Homosexualität noch strafrechtlich verfolgt, in 12 Ländern droht sogar die Todesstrafe für Lesben und Schwule. Machne davon setzen die Todesstrafe auch teilweise um: Iran, Nigeria, Saudi Arabien, Somalia, Jemen. Vielerorts sind staatliche Behörden an der Unterdrückung von Homosexuellen beteiligt, verweigern ihnen jeglichen Schutz vor Anfeindungen und Gewalt.
Auch in den Kirchen streiten sich Christen über kaum ein anderes Thema so leidenschaftlich wie über Homosexualität. Was den einen als selbstverständlich erscheint, bringt andere dazu, ihre Kirchen zu verlassen. Dass Homosexualität eine Sünde, Heterosexualität aufgrund der mit ihr einhergehenden Fortpflanzung dagegen gottgewollt sei, wird in der christlichen Tradition unter Berufung auf biblische Quellen begründet, genauer: vor allem auf alttestamentliche und damit jüdische Quellen. In seinem 2024 erschienen, konsequent durchdachten und erhellendem Buch "Kein anderes Ufer" (nähere Infos weiter unten) hat sich der katholische Theologe Norbert Reck mit Bibel, Geschichte, Psychoanalyse und Sexualwissenschaften auseinandergesetzt und stellt insbesondere auch die theologischen Begründungen für die verheerende Verurteilung von Homosexualtität auf den Prüfstand. Im Ergebnis spricht er von einer "Erfindung der Homosexualität", wie es der Untertitel seines Buches bereits deutlich macht.
Im nachfolgenden ONLINE-EXTRA untersucht er das "Verständnis von Homosexualität in Judentum und Christentum", analysiert die einschlägigen Bibelstellen, die den Grundstein für eine religiös begründete Homophobie legten und zu einem weiteren Baustein christlicher Judenfeindschaft wurden, skizzierte deren verheerende Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart, um abschließend neue Denkwege zur Revision jahrhundertelanger Fehlinterpretationen zu formulieren: "Kein jüdisches Problem. Beobachtungen zum Verständnis von Homosexualität in Judentum und Christentum".
COMPASS dankt Norbert Reck herzlichst für die Genehmigung zur Wiedergabe seines Beitrags an dieser Stelle!
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 361
Fragt man christliche Theologen und Theologinnen, woher die Verurteilung der Homosexualität im Abendland kam, bekommt man oft zur Antwort: aus dem Alten Testament, aus dem Judentum. Im 3. Buch Mose / Levitikus, so meinen viele von ihnen, sei das „Homosexualitätsverbot“ verankert. Und wenn sie begründen sollen, warum der Apostel Paulus so empört darüber war, dass Männer „den natürlichen Gebrauch der Frau aufgegeben haben und in Begierde zueinander entbrannt sind“ (Brief an die Römer 1,27), dann ist der Hinweis auf seine jüdische Herkunft vielen Autoren und Autorinnen Erklärung genug: Es sei schließlich das Judentum, das den gleichgeschlechtlichen Verkehr schon immer abgelehnt habe.
Der international bekannte Neutestamentler E. P. Sanders schreibt zum Beispiel: „Paulus war gegen homosexuelle Liebe – sowohl aktive wie passive und männliche wie weibliche. Dies kennzeichnet ihn als Juden.“ Denn für Juden sei Homosexualität eine „eine Erzsünde. Sie verdammten sie rundheraus.“ Das werde z. B. in Levitikus 18,22 deutlich gesagt und in der späteren jüdischen Literatur wiederholt.1 Die feministische Theologin Bernadette Brooten spricht vom „levitischen Verbot homosexueller Beziehungen“2; Stefan Scholz, Autor des Artikels „Homosexualität“ im WiBiLex, dem wissenschaftlichen Bibellexikon im Internet, schreibt dort, der „Tanach verbietet gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen Männern (Lev 18,22) und fordert hierfür die Todesstrafe (Lev 20,13)“3; der evangelische Neutestamentler Wolfgang Schrage sieht Paulus hier eindeutig in „alttestamentlich-jüdischer Tradition"4, während sein katholischer Kollege Michael Theobald an die „einschlägigen Weisungen der Tora“ und ihre „unheilvolle Wirkungsgeschichte“5 denkt.
Die Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden; die Vorstellung vom jüdischen Ursprung der Ablehnung gleichgeschlechtlicher Sexualität wird immer noch von zahlreichen christlichen Bibelgelehrten geteilt. Doch sie ist sachlich falsch und nährt im Namen einer liberaleren Bewertung der Homosexualität einen Antijudaismus, der den meisten vielleicht gar nicht bewusst ist, aber darum nicht weniger Schaden anrichtet. Es ist höchste Zeit, sich davon zu verabschieden.
Wer wirklich wissen will, woher die Ablehnung des gleichgeschlechtlichen Sexes in unserer Kultur stammt und in welchem Verhältnis sie zum Judentum steht, muss genauer hinsehen und sich auf Überraschungen gefasst machen. Vor allem sollten nicht moderne westliche Begriffe mit Vorstellungen anderer Kulturen und Zeitalter gleichgesetzt oder vermischt werden. Dazu möchte ich auf den folgenden Seiten einige Beobachtungen mitteilen.
I. Die Antike kannte keine „Homosexualität“
Zunächst bedarf der Ausdruck „Homosexualität“ einer historischen Einordnung. Er ist keineswegs ein neutraler wissenschaftlicher Begriff für die gemeinte Sache, sondern stammt aus dem Biologismus des 19. Jahrhunderts. „Homosexualität“ war nicht nur eine Bezeichnung, sondern ein Konzept. Man dachte dabei an eine im Körper verankerte Veranlagung, die bei den Betroffenen gleichgeschlechtliche sexuelle Vorlieben hervorrief. „Die Homosexuellen“ unterschieden sich demnach eindeutig und unabänderlich von „den Heterosexuellen“ – nicht nur in ihrem Verhalten, sondern auch in ihrer Biologie (dazu weiter unten mehr). In anderen Zeiten und Kulturen kannte man dieses Konzept nicht. Wendet man es auf andere Kulturen an, wird man diese nur verzerrt wahrnehmen. Man wird „Homosexuelle“ sehen, wo die Menschen dieser Zeiten und Kulturen lediglich Menschen ohne Unterschiede sahen.
In der Antike etwa kam niemand auf den Gedanken, dass es in sexueller Hinsicht unterscheidbare Gruppen oder gar verschiedene Arten von Menschen gebe. Die Menschheit wurde nicht in Hetero- und Homosexuelle eingeteilt. Gleichgeschlechtlicher Verkehr war etwas, das man praktizierte oder nicht, aber nicht etwas, das auf einem konstitutiven Anderssein beruhte. Grundsätzlich ging man davon aus, dass alle mit allen unabhängig von deren Geschlecht sexuell verkehren konnten, wenn sie das wollten. Sex zwischen Menschen des gleichen Geschlechts war keine Sache, die nur irgendwelche „Anderen“ betraf. Das geht aus zahlreichen Texten, Inschriften und bildlichen Darstellungen aus Kleinasien, Assyrien, Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und Rom hervor. Auch im Alten Israel sah man das so.
Für unser Verständnis der antiken Sexualität hat dies weitreichende Konsequenzen. Da den antiken Kulturen der Veranlagungsgedanke fremd war, werden auch deren Gesetze und Strafbestimmungen, die sich auf gleichgeschlechtlichen Sex beziehen, nicht richtig verstanden, wenn man sie mit der Brille der Veranlagung liest. Diese Gesetze richteten sich nicht an eine solchermaßen veranlagte Gruppe von „Homosexuellen“, sondern – an alle Männer (Sex zwischen Frauen spielte im Nachdenken darüber keine Rolle).
Hätten die diesbezüglichen Gesetze sich nur an besonders veranlagte Menschen gerichtet, dann dürfte man dahinter die Absicht sehen, Minderheiten auszugrenzen. Aber es ging dabei um etwas ganz anderes: um die Sicherung der gesellschaftlichen Rangordnung und ihrer Privilegien. Beim Sex war dafür in den meisten antiken Kulturen die Frage entscheidend, wer penetrierte und wer penetriert wurde. Denn die Penetration galt als Ausdruck von Überlegenheit. Frauen, Sklaven, Kriegsgefangene und Heranwachsende hielt man gesellschaftlich für tieferstehender, deshalb durften sie von erwachsenen Männern penetriert werden. Zwischen freien, gleichrangigen Männern wurde penetrativer Sex hingegen als anstößig empfunden und in manchen Kulturen geächtet. Solcher Sex hätte – so empfand man es – die gesellschaftliche Geschlechter- und Rangordnung gefährdet. Dies ist der Hintergrund etlicher Gesetze und Sanktionen. Nicht ohne Grund wurde mit Blick auf jene Gesellschaften gelegentlich von einer „phallokratischen Ordnung“ gesprochen.
II. Die Gebote im Buch Levitikus
Die einschlägigen biblischen Texte bezüglich gleichgeschlechtlichen Sexes unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von den Maßgaben bei den Nachbarvölkern.
Zwar werden hier – wie in allen antiken Kulturen – ebenfalls nicht irgendwelche „anders“ veranlagten Männer angesprochen, die sich von der Mehrheit eindeutig unterscheiden ließen. Das „Du“ im biblischen Gebot „Du sollst nicht mit einem Männlichen liegen, wie man mit einer Frau liegt“ (Levitikus 18,22) wendet sich an den isch, den freien israelitischen Mann, das Oberhaupt einer Großfamilie, also an den in der Regel verheirateten Familienvater mit Frau(en), Kindern, Eltern, Sklaven und Knechten, kurz: an den Patriarchen eines Familienverbands. Der aber soll – in Kapitel 18, in welchem es um innerfamiliäre Sexualität geht6 – seine Finger lassen von Töchtern, Schwestern, Schwägerinnen oder Mägden und, nach Vers 22, auch nicht mit einem „Männlichen“ liegen, das heißt: mit einem anderen männlichen Mitglied des Haushalts, konkret: mit den eigenen Söhnen, Sklaven und Knechten. (Die Übersetzung „nicht mit einem Mann liegen“ ist in diesem Kontext falsch, denn ein anderer Mann wäre ebenfalls ein isch; ein Haushalt hat jedoch immer nur einen isch). Levitikus 18 richtet sich somit nicht pauschal gegen gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen, sondern zielt auf den Schutz der Minderjährigen und Abhängigen im Haus. Sehr schön formuliert das der Alttestamentler Volker Grunert: „Positiv ausgedrückt gibt dieses Kapitel also allen Hausangehörigen das Recht auf sexuelle Integrität.“7
Während gerade jene Schutzlosen in den anderen Kulturen der Region bedenkenlos zum Sex herangezogen werden durften, weil sie rangniedriger waren, hat Israel hier eine Sexualnorm mit entschieden humanisierendem Charakter entwickelt. Wie Grunert festhält, kann das bis heute von hohem Wert sein: „In der Begleitung von Opfern innerfamiliärer sexueller Gewalt ist dieser Text ein Juwel.“
Von einem „Homosexualitätsverbot“ kann hier also keine Rede sein. Die Texte unterscheiden nirgends zwischen „Homosexuellen“ und „Heterosexuellen“ – sie kannten diese Unterscheidung gar nicht: Alle waren hier in der Pflicht.
III. Die Sodom-Legende
Das ist auch wichtig für das Verständnis der alten biblischen Legende von der Zerstörung der Stadt Sodom (1. Buch Mose / Genesis, Kap. 19). Darin wollen „die Männer von Sodom“ zwei männliche Besucher der Stadt kollektiv vergewaltigen, werden aber durch Gottes Eingreifen daran gehindert. Die Folge ist dann die Zerstörung der ganzen Stadt.
Traditionelle christliche Ausleger lesen die Geschichte meist als Erzählung von einer Stadt voller „Homosexueller“, deren Treiben in diesem Kapitel verurteilt werden sollte. Zur Entstehungszeit des Textes waren solche Vorstellungen jedoch vollkommen fremd. Auch die späteren Schriften der Bibel, die auf die Sodom-Legende Bezug nehmen, sowie die meisten nachbiblischen jüdischen Ausleger dachten hier nicht an die Untaten einer sexuellen Minderheit, sondern an etwas ganz anderes: an Gewalt gegen Fremde, an die reiche Stadt Sodom, die das Gastrecht verletzt und ihren Wohlstand nicht mit anderen teilen will. Für sie war es eine Erzählung über Gier und Eigensucht.
Heutige (v. a. jüdische) Kommentatoren halten zudem fest, dass der Ausdruck „die Männer von Sodom“ für die Stadtmiliz steht8, die gegen unangemeldete Fremde in der Stadt vorging – offenbar auch mithilfe sexueller Gewalt. Dazu musste man keinen Geschmack an gleichgeschlechtlichem Sex haben, sondern vielmehr einen festen Erniedrigungswillen, wie wir ihn auch heute von erobernden Heeren und von Wachmannschaften in Kriegsgefangenen- und Flüchtlingslagern kennen. Das Thema dieser Geschichte ist demzufolge die sexualisierte Gewalt von Milizen und Militärangehörigen, die hier gezeigt und verurteilt wird. (Sie wurde im alten Israel oft genug erlebt, wenn Truppen benachbarter Großmächte erobernd durchs Land zogen.) An besonders veranlagte Menschengruppen dachte niemand; wer also heute „Homosexuelle“ in der Geschichte zu entdecken glaubt, liest aus moderner Sicht etwas in sie hinein, das in ihrer Entstehungszeit niemand im Sinn hatte.
Auf die Frage: Kennt und verurteilt das Alte Testament Homosexualität? antwortet mithin der katholische Alttestamentler Thomas Hieke mit einem entschiedenen Nein.9 Und selbst unter Forschern, die den Begriff „Homosexualität“ noch unkritisch auf die Antike anwenden, sehen manche wie der evangelische Alttestamentler Erhard Gerstenberger, dass die „totale Ächtung der männlichen Homosexualität“ nicht das Ziel der Verse im Buch Levitikus ist, sondern eher eine „Späterscheinung“ in der Zeit der hellenistisch-römischen Herrschaft.10 Auch der Religionswissenschaftler Karl Hoheisel stellt für jene Zeit eine veränderte Einstellung fest: „Stärkere Berührung mit der hellenistischen Welt ließ anscheinend auch Homosexualität als besondere Gefahr erscheinen.“11
Nach landläufiger Meinung ist die Sache mit der »Homosexualität« inzwischen in trockenen Tüchern. Aufgeklärte Gesellschaften haben gelernt, mit Homosexuellen zu leben und deren Diskriminierung abzulehnen. Geht also die jahrhundertealte Konfliktgeschichte zu Ende? In den Sexualwissenschaften schütteln viele mit dem Kopf. Geht man vom tatsächlichen Verhalten der Menschen aus, gelingt es nicht, eindeutig zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen zu unterscheiden. Norbert Reck hat sich mit Bibel, Geschichte, Psychoanalyse und Sexualwissenschaften auseinandergesetzt und kommt zu dem Schluss: Die Erfindung der »Homosexualität« war eine willkürliche Einteilung der Menschen im ordnungssüchtigen 19. Jahrhundert – mit negativen Folgen für die Betroffenen. Die Menschheit lässt sich nicht in unterschiedliche Arten des Begehrens einteilen – es gibt nicht das eine und das andere Ufer. Ein Debatten- und Aufklärungsbuch.
IV. Sexualität im Römischen Reich
Was bedeutete diese „Berührung“ mit der hellenistisch-römischen Welt? Und wie veränderte sie die Sicht auf den gleichgeschlechtlichen Sex? Der Hintergrund der Entwicklung dürfte in der Ausbreitung des Römischen Reichs zu sehen sein. Mit Blick darauf könnte man von einer Militarisierung der Sexualität sprechen.
Das Imperium Romanum, das um 63 v. u. Z. auf dem Landstrich zwischen Syrien und Ägypten Fuß gefasst hatte, war eine Kombination aus Militär- und Kolonialherrschaft. Dazu gehörte, dass die meisten römischen Männer – solange sie noch unverheiratet waren – dem Imperium eine Zeitlang als Soldaten dienten. Sie sorgten für die Einhaltung der pax Romana, d. h. für die Sicherung der Herrschaft in den eroberten Ländern. Gegenüber den unterworfenen Völkern hatten sie hart und unnachgiebig zu sein. Dabei spielte sexualisierte Gewalt eine nicht unwesentliche Rolle. Die Penetration von Angehörigen unterworfener Völker (insbesondere der Männer unter ihnen) demonstrierte augenfällig, wer die Macht besaß und wer die Unterworfenen waren. Der römische Heroenkult spiegelte dies ebenfalls wider, indem er den starken, muskulösen und unbeugsamen Mann idealisierte.
Als Untertanen des Kaisers waren die römischen Soldaten zwar selbst gehorsame Verfügungsmasse, doch wenn sie sexuelle Gewaltakte an kolonialisierten Einheimischen verübten, konnten sie sich überlegen fühlen oder sich zumindest als Angehörige einer überlegenen Macht sehen. (Zu Hause setzten sie das später fort mit Sklaven und Sklavinnen, Minderjährigen und Ehefrauen, die „von Natur aus“ unter den Männern standen.) Im Grunde spielte bei dieser Art Sex das Geschlecht der Penetrierten nur eine untergeordnete Rolle. Es ging nicht um Erotik, Intimität, gegenseitige Anziehung – dieser Sex war bloßes Machtgebaren. Aber als solches war er gesellschaftlich akzeptiert.
Zudem gab sich die Oberschicht in der Stadt Rom gerne orientalischen Kulten hin, die als schick galten und oft zu Sexorgien umfunktioniert wurden. Dafür zog man auch attraktive Sklaven und Kriegsgefangene heran und missbrauchte sie. Von gleichgeschlechtlichem Sex in gegenseitigem Respekt konnte dabei keine Rede sein. (Letzteren gab es auch, aber eher im Verborgenen.)
V. Paulus, Josephus, Philon und andere
All diese Ausprägungen des Sexuellen erregten unter den Angehörigen der unterworfenen Völker des Imperiums häufig Abscheu – schließlich zählten sie selbst oft zu den Missbrauchten.
Stoische Philosophen empfanden diese Art Sex als „widernatürlich“ und entwickelten allmählich ein Misstrauen gegenüber allen Formen menschlicher Leidenschaften. In ihren Augen sollte Sex besser nur zur Fortpflanzung dienen und nur in rechtlich geregelten Beziehungen stattfinden, um sich nicht unkontrollierbaren Leidenschaften auszuliefern.
Auch jüdische Autoren begannen, das erotische Begehren, das im Judentum immer als etwas Gutes galt (vgl. Hoheslied), mehr und mehr zu problematisieren.12 Unter ihnen waren der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der Philosoph Philon von Alexandria, der Apostel Paulus von Tarsus, die Verfasser des apokryphen Weisheitsbuches und anderer Schriften.13 Interessanterweise lebten alle von ihnen in der jüdischen Diaspora, also außerhalb Israels, wo man als Minderheit besonders stark mit der herrschaftsförmigen römischen Sexualität konfrontiert war. Sie lasen die levitischen Gebote und die Sodom-Legende im Lichte ihrer Erfahrungen im Römischen Reich und meinten, darin Warnungen zu erkennen vor jener Sexualität, die sie in ihrer Gegenwart erlebten. Die ursprüngliche Kritik dieser Schriften an soldatischer Gewalt, an der Weigerung, den eigenen Wohlstand zu teilen, am Missbrauch von Abhängigen und am Ehebruch trat in den Hintergrund und machte in ihren Interpretationen nun u. a. der generellen Ablehnung gleichgeschlechtlicher Sexualität Platz.
Man wollte mit der römischen Vermengung von Herrschaft und Sex nichts zu tun haben – und schoss dabei in manchen Punkten übers Ziel hinaus. Bei den wenigen Sätzen, die Paulus über gleichgeschlechtlichen Sex sagt, lässt sich das gut beobachten. Er benutzt zwar die Ausdrucksweise des Buchs Levitikus, wenn er von „mit Männlichen Liegenden“ (1 Kor 6,9) schreibt oder von „Männlichen“, die einander begehrten (Röm 1,27), hat aber etwas anderes vor Augen: nicht den Missbrauch in der Familie oder nebenehelichen Sex, sondern den Sex der römischen Kultorgien und der Soldaten, wobei er aber alles in einen Topf wirft und pauschal verurteilt: Täter wie Opfer, Missbraucher wie Missbrauchte – und selbst einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Sex. Der biblischen Intention „der Sorge um ein gutes und unter dem Segen Gottes stehendes Zusammenleben“14, wie sie in Levitikus 18 und 20 zutage tritt, wird Paulus damit nicht gerecht. Eher bestimmen ihn hier stoische Ideen der „Natürlichkeit“ und der Kritik an ungezügelten menschlichen Leidenschaften.
Gewiss war das eine jüdische Position jener Zeit – die eben erwähnten anderen Autoren dachten ähnlich wie Paulus. Aber man sollte sich hüten, das als „die“ jüdische Sicht, die „schon immer“ gleichgeschlechtlichen Sex verurteilt habe, darzustellen, wie dies manche christliche Autoren tun. Man gerät damit allzu leicht in ein „antijüdisches Fahrwasser“15, wie die feministische Alttestamentlerin Marie-Theres Wacker kritisch anmerkt. Gerade das Judentum im 1. Jahrhundert u. Z. kannte eine besonders große Bandbreite von Auffassungen und Lebensweisen: unterschiedliche Interpretationen der Tora, unterschiedliche Formen der Kultpraxis und selbst unterschiedliche Haltungen gegenüber der Besatzungsmacht.
Andere jüdische Positionen findet man etwa, wenn man den Blick von der Minderheitensituation der Diaspora zurückwendet ins Land Israel in derselben Zeit. Das war zwar zur römischen Provinz Judäa geworden, verfügte aber über ein eigenständiges, höchst lebendiges Judentum mit dem Tempel in Jerusalem, vielen Synagogen und wichtigen Gelehrten. Hier diskutierte man manche sexualethischen Fragen deutlich entspannter. Im 1./2. Jahrhundert wurde – um nur ein Beispiel von vielen zu nennen – im Mischna-Traktat Qidduschin 14,4 die Frage gestellt, ob zwei unverheiratete Männer zusammen unter einer Decke schlafen dürften: eine elegante Umschreibung für gleichgeschlechtlichen Sex. Rabbi Jehuda sprach sich dagegen aus, deshalb wird er namentlich erwähnt – alle anderen Rabbinen aber sahen keinen Grund, das zu verbieten. In diesem Sinne wurde der Text später in den Babylonischen Talmud aufgenommen (Traktat Qidduschin 82a).
So wurde im rabbinischen Judentum in den folgenden Jahrhunderten daran gearbeitet, eine allzu angstvolle Sicht des Sexuellen wieder abzubauen.16 Das Buch der Weisheit, das ein Teil des christlichen Alten Testaments wurde, fand keine Aufnahme in den Tanach, und auch die Schriften Philons von Alexandria und von Flavius Josephus spielten im rabbinischen Judentum keine wesentliche Rolle. Paulus aber, der vermutlich in den 60er-Jahren des 1. Jahrhunderts u. Z. starb, erlebte diese Entwicklung nicht mehr. Für das Christentum blieben seine Briefe – und damit seine unbiblisch-stoische Ablehnung des gleichgeschlechtlichen Sexes – maßgeblich.
VI. Spätantikes und mittelalterliches Judentum
Im spätantiken und mittelalterlichen Judentum ruhte man aufs Ganze gesehen offenbar wieder fest in der biblischen Sicht der Dinge. Was die Sodom-Erzählung angeht, dachte keiner, dass sie etwas mit gleichgeschlechtlicher Lust zu tun haben könnte. Noch im 13. Jahrhundert hielt es Moses ben Nachman (1194–1270) in seinem Tora-Kommentar für den springenden Punkt der Geschichte, dass „die Männer von Sodom“ mit ihrer Gewaltdrohung die Zuwanderung in die Stadt unterbinden wollten, um ihren Reichtum nicht mit Fremden teilen zu müssen.
Auch wo explizit gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen das Thema waren (Lev 18,22 und 20,13), vertrat niemand die Auffassung, dass von den Geboten nicht alle angesprochen seien, sondern nur anders veranlagte Menschen. So spricht zum Beispiel ein Midrasch aus dem 4. Jahrhundert u. Z. davon, dass es in Levitikus 18,22 um das Gewaltgefälle zwischen Erwachsenen und Minderjährigen geht.17 Im Jerusalemer Talmud (entstanden im 5.–8. Jahrhundert u. Z.) kreisen die Überlegungen vor allem darum, wie der nicht ganz klare Ausdruck „wie man mit einer Frau liegt“ zu deuten wäre (die Mehrheit denkt dabei an Penetration). An einer Stelle wird die Überlegung angestellt, dass das Gebot von Levitikus 18,22 jenen helfen könnte, die gegen ihren Willen zum Sex mit einem Mann gezwungen werden.18 Im 11. Jahrhundert hält Raschi (1040–1105), einer der bedeutendsten Kommentatoren von Tanach und Talmud, ausdrücklich fest, dass das Gebot von Levitikus 20,13 sich nicht auf junge Unverheiratete beziehe.19
Nirgendwo finden wir in den nachbiblischen jüdischen Schriften die Vorstellung, dass Menschen, die Lust auf gleichgeschlechtlichen Sex haben, zu einer anderen Art gehören würden und sich dadurch grundlegend von den übrigen Menschen unterschieden. An der grundsätzlichen Gleichheit aller von Gott geschaffenen Menschen meldete niemand Zweifel an.
|
|
|
VII. Zunehmend ein christliches Problem
Die Spur der Homophobie führt somit nicht ins Judentum. Sie führt zur christlichen Theologie. Meist im Anschluss an Paulus wurden die erwähnten Stellen der Hebräischen Bibel immer öfter als Verdammungsurteile über den Sex zwischen Männern gelesen. Doch man dachte noch immer nicht an eine besondere Gruppe von Menschen, wenn man die Männer ermahnte, nicht „auf sodomitische Art“ miteinander zu verkehren. Man glaubte noch lange, dass jeder Mann dazu in der Lage sei.
Im 11. Jahrhundert aber prägte der italienische Benediktinermönch und spätere Kardinal Petrus Damiani, ein unermüdlicher Kämpfer für strenge Kirchenzucht und die Einhaltung des Zölibats, den Ausdruck „Sodomie“20 für den Sex zwischen Männern (Sex zwischen Frauen war für ihn kein Thema). In bewusster Analogie zur Blasphemie, der Gotteslästerung, war das seine Bezeichnung für eine besonders schwere Sünde – eine Todsünde. Aus den Sodomitern, den Einwohnern der Stadt Sodom, wurden nun die „Sodomiten“: noch keine eigene biologische Art, aber doch eine spezielle und unrettbar verdorbene Sorte von Menschen, die mit dem Teufel in Verbindung standen.
Damit wurden erstmals in der Geschichte des Abendlands Männer, die mit anderen Männern Sex hatten, mit einer eigenen Bezeichnung versehen. Diese Bezeichnung markierte sie als Feinde Gottes und stellte sie als besondere Gruppe allen anderen gegenüber. In dieser Sicht machte ihr sexuelles Verhalten sie zu Trägern des Merkmals „Sodomie“. Darin unterschieden sie sich bleibend von den übrigen Menschen. Reue und Umkehr genügten nicht mehr – Petrus Damiani konnte sich eine Vergebung der Sodomie nur noch „am anderen Ende der Todesstrafe“ vorstellen, d. h. nach der Hinrichtung des Sünders.
In der Folge begannen christliche Theologen, die einschlägigen Passagen der Bibel anders zu lesen. Sie sahen nun überall „Sodomiten“ am Werk. Für die ursprünglichen Adressaten der Gebote und göttlichen Strafgerichte (übergriffige Familienväter, Milizionäre) hatten sie keinen Blick. Mit der fiktiven Gruppe der „Sodomiten“ war nun eine Minderheit geschaffen, die dann regelmäßig für sexuell „Ungeordnetes“, aber auch für Erdbeben, Überschwemmungen, politische Intrigen usw. verantwortlich gemacht wurde. Und ab 1215 wurden diese Sodomiten vom kirchlichen wie vom zivilen Strafrecht verfolgt. Ihnen drohten Kastration, Blendung, Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen usw.
Nebenbei: Diese Markierung von Menschen als Sodomiten seit dem 11. Jahrhundert hat eine Parallele in der Tatsache, dass Juden in Europa ebenfalls seit jener Zeit immer stärker ausgegrenzt wurden und auf Beschluss des IV. Laterankonzils 1215 sich durch Zeichen an ihrer Kleidung kenntlich machen mussten. Gewiss, hier ist nichts gleichzusetzen – die Formen der Diskriminierung und Verfolgung sind ganz unterschiedlich. Doch es war offenbar eine Zeit, in der das europäische Mittelalter stärker als zuvor das Bedürfnis entwickelte, bestimmte Menschengruppen als Nichtzugehörige zu kategorisieren – als Hexen, Juden, Türken (= Muslime) und als Sodomiten.
VIII. Von der Sodomie zur Homosexualität
Im 19. Jahrhundert machte die Entwicklung einen Sprung nach vorn: Aus der „Sodomie“ wurde die „Homosexualität“. Der 1869 geprägte Begriff, der zuerst in einer Berliner Publikation auftauchte, aber bald internationale Verwendung fand, brachte den Geist jener Zeit präzise auf den Punkt: Er ließ das moraltheologische Verdikt, das im Begriff der Sodomie steckte, hinter sich und klang modern, seriös und wissenschaftlich. Ursprünglich durchaus mit emanzipatorischen Absichten.
War das ein Fortschritt? Zumindest wollte man es gerne so sehen. Doch der Aufstieg von Medizin und Biologie zu den Leitwissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts führte nicht immer zur Beschränkung auf objektive naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern häufig nur zum hingebungsvollen Glauben an die Verankerung der Unterschiede der Menschen in ihrer biologischen Ausstattung: im Gehirn, in den Hormonen, im Blut, im Uterus, in den Erbanlagen.
Man vermaß Schädel und Knochenbau von Menschen in den Kolonien und ordnete sie „niederen Rassen“ zu. Bei Frauen, die um ihre Gleichberechtigung kämpften, diagnostizierte man häufig Hysterie, die nur aus dem Uterus kommen konnte. Die Vermessung der Augenhöhlen, Augenabstände und Kinnpartien von Gefängnisinsassen führte zur Theorie der „geborenen Kriminellen“.21 Und selbstverständlich wurden jetzt auch Juden als eine „Rasse“ betrachtet, wie der gleichfalls neugeprägte Begriff des Antisemitismus nahe legen wollte.
Ebenso glaubte man, für gleichgeschlechtliche sexuelle Präferenzen körperliche Ursachen feststellen zu können: Homosexualität galt nun als „naturgegebene“ Veranlagung einer Minderheit. Ihre Träger waren nicht mehr – wie in früheren Kulturen und Zeiten – Gleiche unter Gleichen, sondern Angehörige einer anderen Menschenart. Da halfen keine Bußübungen mehr. Der Philosoph Michel Foucault charakterisierte den Unterschied zum früheren Denken folgendermaßen: „Der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle war eine Spezies.“22
Mit anderen Worten: Man unterteilte die Menschheit nun in verschiedene sexuelle Spezies, in Menschenarten, und kündigte damit nun endgültig die Vorstellung von der geschöpflichen Gleichheit aller Menschen auf. Auch im Judentum, das lange die biblische Überzeugung von der einen, unteilbaren, von Gott geschaffenen Menschheit hochhielt, verbreitete sich nun die Vorstellung, es gebe unterschiedlich veranlagte Gruppen, da es sich nun ja nicht mehr um eine christlich-theologische, sondern um eine biologische Vorstellung handelte.
Aber war es denn kein Fortschritt, die Sache nicht mehr moralisch zu beurteilen, sondern von einem medizinischen Standpunkt aus, der klar besagte, dass die Betroffenen nichts für ihre Veranlagung konnten? Viele dachten so, aber es war eine Illusion. Denn es gab in jener Zeit nicht die geringsten neuen klinischen Erkenntnisse über das gleichgeschlechtliche Begehren. Die biologische Verankerung des Begehrens war lediglich eine Behauptung, eine Art moderner Glaube, als der Glaube an die Religionen zunehmend verblasste.
Die von der Diagnose der „Homosexualität“ Betroffenen aber, die sich davon eine Befreiung von kirchlichen Schuldsprüchen durch die Wissenschaft versprochen hatten, sahen sich alsbald einem Diskurs ausgeliefert, der noch unerbittlicher war, weil er sich auf die Autorität vermeintlich wissenschaftlicher Fakten berief. Die frischgebackenen Homosexuellen wurden zu begehrten Studienobjekten der Medizin und der noch jungen Wissenschaft der Psychiatrie. Man untersuchte sie auf ihre Vorgeschichte, ihren familiären Hintergrund, auf Erbkrankheiten und auf psychische Anomalien hin, um die Ursachen ihrer Abweichung von der Norm ausfindig zu machen. Die Norm – der soldatische, heterosexuelle Mann – wurde indessen nicht infrage gestellt.
Und natürlich wollte man die Homosexualität bald nicht nur erforschen, sondern auch „heilen“. Die Palette der Behandlungsversuche reichte vom Einpflanzen „heterosexuellen“ Drüsengewebes in „homosexuelle“ Individuen, von Hormonbehandlungen, Verpflanzungen von Eierstöcken über Kastrationen, Sterilisierungen und Elektroschocks bis hin zu Hypnose und medikamentösen Behandlungen in den Psychiatrien und ab den 1950er-Jahren zu stereotaktischen Eingriffen am Gehirn. Der Weg der Versuche führt von der Freiwilligkeit zu Zwangsmaßnahmen, im NS-Staat zu massenhaften Sterilisierungen und medizinischen Experimenten in den Konzentrationslagern. Nach 1945 erlangte man die Einwilligung zu Operationen häufig, indem man den Betroffenen Straffreiheit in Aussicht stellte, hatten doch viele von ihnen gegen den § 175 verstoßen, der gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe stellte. Wirkliche Erfolge der Eingriffe gab es kaum, aber zahlreiche Patienten bezahlten sie mit geistiger Umnachtung oder mit ihrem Leben.23
Zusammenfassend gesagt: Mit der Ersetzung des christlich-theologischen Urteils der Sodomie durch die „naturwissenschaftliche“ Idee der Homosexualität wurden die medizinisch beglaubigten Homosexuellen nun endgültig als biologisch Andere aus der allgemeinen Menschheit ausgesondert: Sie galten nicht mehr als Sünder, sondern als eine „Sondernatur“ (Michel Foucault). Ihre „Veranlagung“ war ihr Schicksal. Aus diesem Anderssein gab es kein Entrinnen mehr. Mehr Diskriminierung ist kaum denkbar.
Natürlich kann man fragen: Sind diese Leute nicht tatsächlich anders? Schließlich unterscheiden sie sich doch wirklich in ihren sexuellen Vorlieben und ihrer Praxis von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Kann man mit einer guten Portion Toleranz für das Anderssein dieser Menschen der Diskriminierung nicht einfach den Wind aus den Segeln nehmen – und die Sache wäre erledigt? Das klingt unaufgeregt und großzügig. Doch ausgrenzendes Denken bleibt ausgrenzendes Denken, auch wenn man das Anderssein der Anderen positiv bewertet. Die Anderen sind per definitionem „nicht wie wir“, auch wenn man sie „okay“ findet. Der diskriminierenden Dichotomie, der Gegenüberstellung von „Normalen“ und „Anderen“ entgeht man dadurch nicht. Es bleibt ein Denken der grundsätzlichen Ungleichheit, ein Denken in Gruppen, Spezies, Arten und Rassen – ein Denken, das in den Jahrzehnten danach immer schlimmere Folgen zeitigte.
Die Sache sähe anders aus, wenn man dabei nicht an zu unterscheidende Gruppen denken würde, sondern an individuelle Vielfalt. Schließlich haben alle Menschen ihre individuellen Eigenheiten und ein Recht darauf, dass diese respektiert werden. Das war ungefähr auch die Haltung im frühen Judentum. Doch im 19. Jahrhundert ging gerade diese Vorstellung von individueller Vielfalt verloren, als man einen Teil der unterschiedlich Begehrenden zu einer Gruppe mit biologischen Fehlformen, zu Missgeburten erklärte. Viele Betroffene erlebten ihr Begehren nicht mehr als etwas, was sie wollten, sondern als etwas, das sie aus ihrer körperlich-seelischen Verfassung heraus tun mussten. An die Stelle von Scham über „unmoralisches“ Verhalten traten nun der Ekel vor sich selbst und – aus Verzweiflung über das eigene vermeintliche „So-Sein“ – immer wieder Selbstmorde.
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
IX. Der feste Glaube ans Anderssein
1974, gut hundert Jahre nach ihrer Erfindung, wurde die Homosexualität von der American Psychiatric Association aus ihrem Katalog der geistigen Erkrankungen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wieder gestrichen. Und seit 1991 führt auch die Weltgesundheitsorganisation die Homosexualität nicht mehr in ihrer Internationalen Klassifikation der Krankheiten (International Classification of Diseases). Mehr als ein Jahrhundert der „wissenschaftlichen“ Erforschung der Homosexualität wurde so zum Irrweg erklärt.
Hierzu kam es, weil ein seriöser Nachweis medizinisch-pathologischer Ursachen der Homosexualität nie erbracht werden konnte. Alle Theorien über Keimdrüsen, Hormoneinwirkungen auf verschiedene Körperregionen, anatomische Unterschiede im Gehirn oder über spezielle Chromosomen und deren Bedeutung für die Entstehung der Homosexualität wurden regelmäßig aufgrund wissenschaftlicher Mängel bzw. interessengeleiteter Vorannahmen widerlegt oder durch Kontrolluntersuchungen in Frage gestellt.24
Bestehen blieb aber der Glaube großer Teile der Bevölkerung zumindest westlicher Länder, dass es die Homosexualität „gibt“ (wenn nicht als Krankheit, so doch als unabänderliches Merkmal bestimmter Menschen) und dass die Menschheit aus Heterosexuellen und Homosexuellen (und allenfalls noch ein paar Bisexuellen) bestehe. Das gilt bis heute weithin als Stand der modernen Wissenschaft.
Und so lebt die grundlegende Diskriminierung von Menschen mit gleichgeschlechtlichen sexuellen Wünschen weiter fort. Die „Anderen“ sollen zwar nicht mehr verächtlich gemacht werden, doch ihr Anderssein steht nicht infrage. Dabei wird dieser „Stand der Wissenschaft“ von zahlreichen Sexualforscherinnen und -forschern seit Langem infrage gestellt (dazu mehr im letzten Abschnitt).
Ich will hier nicht darüber spekulieren, woher das hartnäckige Festhalten am Konzept der Homosexualität trotz ihrer Gewaltgeschichte kommt – ob dies den Menschen in einer unübersichtlichen Welt mehr Sicherheit gibt, ob der Glaube an die Erklärungskraft der Genetik inzwischen quasireligiösen Charakter angenommen hat oder ob die binären Denkformen wir/die, normal/anders, hetero/homo, weiß/schwarz, männlich/weiblich so tief sitzen, dass viele nicht mehr darauf verzichten können. Das müsste einmal eingehend untersucht werden. Hier ging es mir nur darum, den Punkt zu beschreiben, an dem wir heute stehen.
X. Neue Denkwege
Was könnte man tun? Man könnte auf jene gar nicht so marginalen Sexualwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler hören, deren Erkenntnisse in der Diskussion bislang meist nicht zur Kenntnis genommen werden. Sie gehen seit etlichen Jahrzehnten davon aus, dass die Idee der Homosexualität als Merkmal einer Minderheit eine irrige Vorstellung ist, der in der Wirklichkeit nichts entspricht.
Ich nenne nur drei Beispiele25: In den 1930er- und -40er-Jahren wies der US-amerikanische Zoologe Alfred Kinsey in empirischen Untersuchungen von bis dahin nicht gekanntem Umfang nach, dass unter den Menschen keine fein säuberlich geschiedenen Populationen von Heterosexuellen und Homosexuellen zu finden sind. Homosexuelles Handeln komme bei den meisten Menschen zumindest gelegentlich vor; man könne es keinen besonderen Gruppen zuordnen. Die reale Welt lasse sich nicht in Schafe und Böcke aufteilen. „Nur der menschliche Geist führt Kategorien ein und versucht, die Tatsachen in bestimmte Fächer einzuordnen.“
Die britische Soziologin Mary McIntosh zeigte in den 1960er-Jahren, dass es nie gelungen ist, ausreichend große Gruppen von ausschließlich homosexuellen Probanden für Studien zu finden, wenn man nicht nach ihrer Selbstbezeichnung, sondern nach ihrem konkreten Sexualverhalten fragte. Ebenso schwierig war es, „lupenreine“ heterosexuelle Kontrollgruppen aufzutreiben. Immer lebten die Leute anders, als es die Grenzlinien dieser Begriffe vorsahen.
Vor allem aber war es der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der nach Jahren der Therapiesitzungen mit zahlreichen Klienten keinen Sinn mehr darin sehen konnte, zwischen den Einen und den Anderen zu unterscheiden. Im Jahr 1915 fügte er in die Neuauflage seiner Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie die Anmerkung ein:
„Die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen. Indem sie auch andere als die manifest kundgegebenen Sexualerregungen studiert, erfährt sie, daß alle Menschen der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und dieselbe auch im Unbewußten vollzogen haben.“26
Mit anderen Worten: Das reale Empfinden und Verhalten der Menschen lässt nicht den Schluss zu, dass die Menschheit aus Hetero- und Homosexuellen besteht. Alle Menschen begehren (unter anderem) Menschen des gleichen Geschlechts; manche bewusst, manche unbewusst. Und selbst in ihrem konkreten Sexualverhalten unterscheiden sie sich allenfalls tendenziell oder quantitativ voneinander. Demzufolge ist es unmöglich, „die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen“.
Wollte Freud damit sagen, dass die Menschen frei wählen können, mit welchen Geschlechtsangehörigen sie sexuelle Beziehungen unterhalten wollen? Nein. Natürlich wusste Freud sehr genau, dass niemand sein Begehren bewusst steuern kann. (Wir können nicht einmal bewusst steuern, ob wir lieber Bier oder Wein mögen oder keines von beiden.) Er hielt nur fest, dass alle Menschen zu allen Formen des Begehrens fähig sind und deshalb ursprünglich bisexuell sind. Im Laufe ihrer Entwicklung trete aber das eine oder das andere Geschlecht für das Begehren in den Vordergrund (wobei das in den Hintergrund getretene Begehren weiterhin im Unbewussten präsent bleibe).
Wie es dazu kommt, dass allmählich die Vorliebe für ein bestimmtes Geschlecht einstweilig festgeschrieben wird, konnte Freud nicht erklären – und auch niemand sonst, bis heute. Als psychoanalytisch gesichert gilt nur, dass sexuelle Vorlieben nichts mit einer biologischen Veranlagung zu tun haben, sondern mit den komplexen und vielfältigen Erfahrungen der jeweiligen Lebensgeschichte. Und diese können sich immer wieder ändern. Das einmal Festgeschriebene kann umgeschrieben werden. Tatsächlich ändern viele Menschen ihre sexuellen Vorlieben im Lauf des Lebens (manche mehrfach) und widerlegen damit zugleich die Vorstellung, ihre Gene bestimmten, von welchem Geschlecht sie sich angezogen fühlen.
Diese Beobachtungen stimmen in erstaunlicher Weise mit der Tora (und fast allen anderen menschlichen Kulturen) überein. Dass die Tora keine unterschiedlich begehrenden Menschenarten kennt, ist mit Blick auf Freud (und andere) nicht naiver als die moderne Vorstellung einer homosexuellen Veranlagung, sondern realitätsnäher.
Griffe man diese Erkenntnisse der Sexualwissenschaft auf, wäre demnach von der grundlegenden Gleichheit aller Menschen auszugehen – bei gleichzeitiger Vielfalt aller individuellen Neigungen und Vorlieben. Das Denken in den Kategorien von Mehrheit und Minderheit mitsamt seinen Ausgrenzungstendenzen ließe sich damit Schritt für Schritt überwinden. Die Politik könnte gleiche Rechte für alle Menschen voranbringen, anstatt Sondergesetze für Minderheiten zu erlassen. Die Sexualpädagogik könnte jungen Menschen die Angst vor gleichgeschlechtlichen Gefühlen nehmen, weil nicht nur Minderheiten, sondern alle Menschen sie haben. Und die Bibelwissenschaft könnte ihren Orientalismus (Edward Said) überwinden, indem sie aufhörte, „Homosexualitätsverbote“ in biblischen Texten ausfindig zu machen und sie dem Judentum anzukreiden. Sie müsste nicht mehr nach Homosexuellen in der Bibel suchen und nicht wieder und wieder darüber spekulieren, ob David und Jonatan „homosexuell“ waren. Sie könnte sich einfach daran freuen, wie die beiden Männer, die verheiratet waren und Kinder hatten, ihre Liebe zueinander lebten und miteinander über ihre Trennung weinten (1 Sam 20,41), ohne sich dafür zu schämen.
Gerade der Blick auf die Bibel kann lehren: Die Menschheit war schon einmal weiter als unsere sich wissenschaftlich wähnende Gegenwart. Aber genau deshalb ist ihr Fall auch nicht hoffnungslos. Die Aufgabe, vor der wir heute stehen, liegt darin, die Vielfalt aller menschlichen Verhaltensweisen nicht irgendwelchen Gruppen von Anderen zuzuschreiben, sondern als Gemeingut aller Menschen zu verstehen. Es gilt zu lernen, Vielfalt und Gleichheit als Einheit zu denken, nicht als Gegensatz.
ANMERKUNGEN
1 E. P. Sanders, Paulus. Eine Einführung, Stuttgart: Reclam 1995 (Oxford 1991), S. 166 u. 169.
2 Bernadette J. Brooten, Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Die weibliche Homoerotik bei Paulus, in: Monika Barz u. a. (Hg.), Hättest du gedacht, daß wir so viele sind? Lesbische Frauen in der Kirche, Stuttgart 1987, S. 113–138, hier S. 129.
3 Scholz, Stefan, Art. Homosexualität, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), 3.2.2. Judentum, 2012 (Version 2018).
4 Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther, EKK VII/1, Neukirchen 1991, S. 430.
5 Michael Theobald, Biblische Weisungen zur Homosexualität? Plädoyer für einen vernünftigen Umgang mit der Schrift, in: Wort und Antwort 39 (1998), S. 92–94, hier S. 94.
6 Unbesprochen bleibt hier Levitikus 20,13, das mit fast gleichlautenden Formulierungen sich auf nebenehelichen Sex der Familienväter bezieht. Näheres dazu in meinem Buch Kein anderes Ufer. Die Erfindung der Homosexualität und ihre Folgen, Ostfildern 2024, S. 38–42.
7 Volker Grunert, Lest Ihr ihnen die Leviten! Wen die „Homo-Texte“ der Bibel wirklich im Blick haben, online unter: www.Queer.de, 30. Dezember 2021.
8 Vgl. z. B. David Stein (Hg.), The Contemporary Torah, wo mit Verweis auf andere Stellen der Bibel (z. B. Gen 34,20; Ri 20,2) ’anshe ha-‘ir (die Männer der Stadt) mit „town council“ und ’anshe sedom (die Männer von Sodom) mit „militia of Sodom“ übersetzt werden.
9 Thomas Hieke, Kennt und verurteilt das Alte Testament Homosexualität? in: Stephan Goertz (Hg.), „Wer bin ich, ihn zu verurteilen?“ Homosexualität und katholische Kirche, Freiburg i. Brsg. 2015, S. 19–52, hier S 19.
10 Erhard Gerstenberger, Das dritte Buch Mose. Levitikus (ATD 6), Göttingen 1993, S.232 und 271f.
11 Karl Hoheisel, Art. Homosexualität, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 16 (1994), Sp. 289–364, hier Sp. 333.
12 Vgl. Daniel Boyarin, A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity, Berkeley u. a. 1997; David Biale, Eros and the Jews, New York 1992.
13 Vgl. etwa Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae 1,200; ders., Contra Apionem 2.199, 2.215, 2.273; Philon von Alexandria, De Specialibus Legibus 3,37–42; Paulus, Römer 1,22–31, 1 Korinther 6,9–10; Aristeasbrief 151f; Buch der Weisheit 14,23–26; Orakel der Sibylle 5,166; Pseudo-Phokylides 210–217.
14 Marie-Theres Wacker, „Altes Testament“ trifft „Theologische Frauen- und Geschlechterforschung“, in: dies. (Hg.), Wozu ist die Bibel gut? Theologische Anstöße, Münster 2019, S. 257–276, hier S. 268.
15 Wacker, ebd.
16 Boyarin, A Radical Jew, S. 159f.
17 Midrasch Sifra Kedoschim 10,11.
18 Um nur wenige Belege im Jerusalemer Talmud zu nennen: Horajot 4a,15; Jevamot 8,6,5; Jevamot 54b,9; Jevamot 83b,10; Keritot 3a,14; Sotah 26b.13; Sanhedrin 9b,7.
19 Vgl. Raschi (Rabbi Schlomo ben Jizchak), Sifra Kedoschim 10,8.
20 Petrus Damiani, Liber Gomorrhianus (= Epistola 31), in: Kurt Reindl (Hg.), Die Briefe des Petrus Damiani (Monumenta Germaniae Historica 4), Bd. 1, München 1983, S. 284–330. Zur Analyse vgl. Mark D. Jordan, The Invention of Sodomy in Christian Theology, Chicago/London 1997, S. 42–44.
21 Vgl. Dirk Burczyk, Polizei und Kolonialismus. Eine Einleitung, in :Bürgerrechte & Polizei/CILIP 136 (2024), S. 3–12, hier S. 10f.
22 Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit, Bd. I: Der Wille zum Wissen, Frankfurt am Main 1983, S. 58.
23 Einen gerafften Überblick gibt Heinz-Jürgen Voß, Biologie & Homosexualität. Theorie und Anwendung im gesellschaftlichen Kontext, Münster 2013.
24 Vgl. ebd, S. 46–70.
25 Belege und weitere Beispiele in Reck, Kein anderes Ufer, Kapitel V. Für eine moderne Sicht des sexuellen Begehrens der Menschen, die tatsächlich auf dem Stand der Sexualwissenschaft ist, vgl. ebd. das Kapitel VI.
26 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (ursprgl. Leipzig/Wien 3. Aufl. 1915), zit. n. ders., Psychoanalyse. Ausgewählte Schriften, Leipzig 1990, S. 120–228, hier S. 132f.
Der Autor
*****
ist katholischer Theologe (Dr. theol.) und freier Autor. Er ist Mitglied im Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken und interessiert sich vor allem für die Überwindung der christlichen Judenfeindschaft und für die emanzipatorischen Potenziale der biblischen Schriften. Zuletzt erschien von ihm »Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums. Zum Riss zwischen Dogma und Bibel. Ein Lösungsvorschlag« (Grünewald, 3. Aufl. 2021), sowie "Kein anderes Ufer. Die Erfindung der Homosexualität und ihre Folgen" (Grünewald 2024).
Kontakt zum Autor und/oder COMPASS:
redaktion@compass-infodienst.de