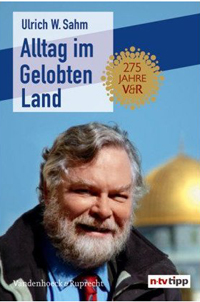ONLINE-EXTRA Nr. 116
© 2010 Copyright bei Verlag und Autor
Als Nahost-Korrespondent ist er Zeitungslesern und Fernsehzuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit langem bekannt: Ulrich W. Sahm. Seit 1970 berichtet er in Bild und Text aus Jerusalem. Jetzt hat er seine Eindrücke und Erfahrungen in einem ebenso kenntnisreichen wie unterhaltsamen Buch niedergeschrieben: "Alltag im Gelobten Land".
Sein Buch vermittelt einen tiefen Einblick in das Alltagsleben in Israel und gibt seinen Lesern und Leserinnen die Gelegenheit, aus der Innenperspektive heraus zu verstehen, was das Leben in diesem nahen und doch fremden Nachbarland antreibt und hemmt. Dabei stehen Kriegs- und Terrorschrecken neben archäologischen Sensationen, kulinarische Entdeckungen neben politischen Absurditäten, Menschliches neben Allzu-Menschlichem und leider auch Unmenschlichem. Eine Vielzahl plastischer, oft auch skurriler Beispiele illustriert neben zahlreichen, farbigen Abbildungen die Kernbotschaft des Bandes: Nur gemeinsam werden die Bewohner dieser Jahrtausende alten Kulturlandschaft eine Lösung ihrer Probleme finden; Respekt füreinander, Kenntnis voneinander und nicht zuletzt Humor im Umgang miteinander sind wichtige Eckpfeiler in diesem Prozess.
COMPASS freut sich, Ihnen heute Sahms "Autobiographische Vorwort" und sein Nachwort, "Ein Blick zurück", als ONLINE-EXTRA Nr. 116 präsentieren zu können, ergänzt von einer Rezension des Buches aus der Feder von COMPASS-Gast-Autor Hans Maaß.
COMPASS dankt Ulrich W. Sahm für die Genehmigung zur Wiedergabe der Buchauszüge an dieser Stelle sowie Hans Maaß für die beigefügte Rezension des Buches.
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 116
Der Mensch besteht aus zwei Teilen. Dem, was er ist, und dem, was er daraus macht. Niemand kann sich seine Eltern auswählen, den Ort, wo er geboren ist, seine Muttersprache, die Kultur und Umgebung, in der er aufwächst. Was er daraus macht, welche Lehren er aus den Vorgaben zieht, und sogar, wie er auf Schicksalsschläge reagiert und wie er sich sein Leben einrichtet, steht voll in seiner eigenen Verantwortung.
Autobiografisches Vorwort
Und vorstellen würde ich mir absurde, komische,
erstaunliche, bedrückende,
schöne, traurige Episoden, die den ganz normalen
Irrsinn einfangen,
das Leben in Israel »fassbar« machen und
Deutschen eine Chance geben,
sich ein Bild zu machen.
Mein Leben hat seit 40 Jahren in Jerusalem seinen Mittelpunkt. Auch nach so vielen Jahren habe ich mich nicht an die Wucht der Geschichte dieser Stadt gewöhnt. Die Vielfalt der Menschen, Kulturen, Sitten und Religionen faszinieren täglich aufs Neue. Viele Menschen sehen in Jerusalem den Mittelpunkt der Erde. Ich verspüre die Anziehungskraft dieser Stadt, genieße es, von einem Jahrhundert ins andere zu wandern, indem ich nur die Straßenseite wechsle. Und gleichzeitig bleibt man ein Fremder in dieser Stadt. Denn jeder Bürger Jerusalems, Jude, Armenier, Grieche, Moslem oder Christ, lebt in einer anderen und mir letztlich fremden Welt. Zu dieser »fremden« Welt gehört auch der Nahostkonflikt mit Jerusalem in seinem Epizentrum und seismischen Wellen in aller Welt. Als Deutscher und journalistischer Beobachter genieße ich es, nicht Partei ergreifen zu müssen und jederzeit die Fronten überschreiten zu können. Mit diesem Buch will ich versuchen, den Leser an die Hand zu nehmen und durch diese fremden – nicht immer, aber auch – exotischen Welten zu führen, denen man in Jerusalem und im ganzen Land begegnen kann, auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite.
Ich kann nichts dafür, dass ich ausgerechnet im Bundeshauptdorf Bonn geboren wurde, weil mein Vater im Auswärtigen Amt als Diplomat Karriere machte. Das Schicksal wollte es, dass meine Mutter aus einer uralten Adelsfamilie stammt und ich den berühmten Lügenbaron von Münchhausen zu meinen direkten Vorfahren zählen darf. Von mir nicht beeinflusst wurde ich »Ulrich Wilhelm« getauft – nach meinem Onkel Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, der am Putsch gegen Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt war und von Freisler zum Tode verurteilt wurde.
Es war mein Schicksal, dass ich mit meiner Familie im Alter von vier Jahren nach London zog und dort das Rechnen lernte. Die verbreitete Annahme, dass man die »Muttersprache« eines Menschen ermitteln könne, indem man prüft , in welcher Sprache er rechnet, kann ich am eigenen Beispiel bestens widerlegen. Bis heute zähle ich in Englisch. Unser Pastor in London war übrigens Eberhard Bethge, ein Weggefährte Dietrich Bonhoeffers, der auch nach unserem Weggang aus London mit meinen Eltern befreundet blieb und mir in lebendiger Erinnerung ist. Mein Vater wurde 1962 zur Nato-Botschaft in Paris versetzt, als ich 12 war. Meine Eltern beschlossen, mich in die »internationale Sektion« des französischen Lycée de Sèvre zu stecken, während meine Geschwister die deutsche Schule besuchten.
Hier begann nun meine Geschichte mit dem Land, das mein Leben prägte: Die israelische Schule in Paris war auf die Grundschule beschränkt. So kam es, dass ein Viertel meiner Mitschüler Israelis waren, Diplomatenkinder und Kinder von Israelis, deren Tätigkeiten in Frankreich etwas »undurchsichtig« waren. Darüber hinaus waren erstaunlich viele meiner Lehrer und Mitschüler, auch aus anderen Ländern, Juden – wie ich allerdings erst später, in höheren Klassen, erfuhr. Als ich mich während des Unterrichts gerade mal im Tiefschlaf befand, weckte mich die (jüdische) Französischlehrerin plötzlich aus meinen Träumen. »Das Thema, über das wir gerade reden, sollte dich ganz besonders interessieren«, sagte sie. Etwas verwirrt fragte ich, worum es ginge. »Die Tagebücher der Anne Frank.« Völlig ahnungslos fragte ich sie, wieso mich das mehr interessieren sollte als alle anderen. Es hatte auch vorher schon Vorfälle gegeben, die mich erst im Nachhinein prägten, weil ich sie zunächst nicht verstand.
Dann war ich mit einem Amerikaner befreundet, der mich zu sich nach Hause eingeladen hatte. Seine Eltern empfingen mich mit den Worten, ich sei der erste Deutsche, der ihr Haus betrete. »So what? Na und?«, war meine Reaktion mit 14. Erst später erfuhr ich, dass sie Juden waren und verstand die historische Dimension.
Ganz intuitiv, aber wohl nicht zufällig entstand eine intensive Freundschaft der sechs Israelis in meiner Klasse mit mir, dem einzigen Deutschen. Ausschlaggebend dürft en zwei Elemente gewesen sein: Zum einen besuchte ich gerade den Konfirmationsunterricht an der deutsch-evangelischen Kirche in Paris und interessierte mich sehr für religiöse Fragen. Zum anderen gab es einige nicht sonderlich sympathische Franzosen in meiner Klasse, die mich unter dem Einfluss der anti-deutschen Filme im Fernsehen mit »Heil Hitler« grüßten. Ich verstand das alles nicht so recht, meine israelischen Klassenkameraden aber waren in den historischen Zusammenhängen besser bewandert und kapierten, dass ich da in unfairer Weise diskriminiert wurde. Bruchstückhaft schnappte ich in den Schulpausen Hebräisch bei meinen Freunden auf und begann es zu lernen. Um die Schrift einzuüben, kauft e ich mir die jiddische Zeitung Letzte Naijes. Die war zwar hebräisch gedruckt, aber jiddisch geschrieben. So verstand ich wenigstens ungefähr, worum es ging, und gewöhnte ich mich autodidaktisch an die fremde Schrift.
Der Kontakt mit Oded, Schlomo, Zeev, Talma und Hava Hadar blieb bestehen, als ich mit 16 nach Deutschland ins Internat kam, um ein deutsches Abitur zu machen. Nach vier Jahren Frankreich, wo Französisch die Lehrsprache, Englisch die selbstverständliche Nebensprache und Spanisch die erste Fremdsprache war, konnte ich eigentlich nicht mehr richtig Deutsch. Racine und Molière waren mir geläufiger als Goethe und Schiller. So geschah es, dass ich Nachhilfeunterricht im Deutschen nehmen musste.
Der jüdische Aspekt, der für mich schon in Paris zu einer Selbstverständlichkeit geworden war, wurde an der Odenwaldschule durch den damaligen Mentor dieser Schule, Ernest Jouhy, noch intensiviert. Während des Unterrichts rauchte er Gauloises und erzählte uns von seinen persönlichen Freunden Sartre und Camus. Die rot und blau eingebundenen Werke von Marx, Engels und Lenin standen bei ihm nicht nur im Bücherschrank. Er hatte sie sogar gelesen. In Sonderkursen lehrte er die atheistische Weltanschauung von Kohelet, dem »Prediger Salomos« der Bibel. Jouhys Weisheiten waren ein intellektuelles Vergnügen, das zweifellos nicht nur mich prägte. Es gab da noch einen anderen Schüler: Sein Abitur hatte er just gemacht, als ich eingeschult wurde. Aber er kam immer wieder, um Vorträge zu halten – oder sogar um unterzutauchen: Dany, der Rote – Daniel Cohn-Bendit, der in Frankreich die europäische Revolution von 1968 mit ausgelöst hatte.
Mit einem Stipendium des Internats Salem reiste ich nach dem Abitur zum ersten Mal nach Israel. Ich hatte eine lächerlich geringe Summe Geld zur Verfügung. Die reichte kaum für das Ticket der griechischen Fähre von Ancona in Süditalien nach Haifa. Ich reiste also per Schiff in der »dritten Klasse« ohne Verpfl egung und lernte neben allen möglichen jungen Frauen auch Avri kennen, einen Jemeniten aus Petach Tikwa bei Tel Aviv. Wir begegneten uns in der Jugendherberge in Ancona, schon vor der Einschiffung. Er betrat den Gemeinschaftssaal mit einem großartigen »Schalom«. Da ich ja auf dem Weg nach Israel war, sprach ich ihn an. Wir verabredeten uns zu einer idiotischen Rundfahrt mit einem Tretboot und er fragte mich, wie ich heiße. »Ulrich« oder »Ulli« könne kein Israeli aussprechen, bestimmte Avri und beschloss daraufhin noch vor meiner Ankunft in Israel, dass ich mich gefälligst »Uri« nennen sollte.
Avri bestellte seine halbe Familie nach Haifa, um ihn abzuholen. Die Autokolonne bestiegen auch andere, Deutsche und Holländer, die Avri auf dem Schiff »eingesammelt« hatte. So fuhren wir nach »Machane Jehuda«, dem jemenitischen Viertel von Petach Tikwa.
Auch dieses Erlebnis prägte mein Leben. Ich verbrachte meine erste Nacht in Israel im Schlafsack auf der Terrasse von Juden aus einem fernen arabischen Land. Sie hatten ihre eigene Kultur, duftende Gewürze und unbekannte Speisen mitgebracht. Die lernte ich schon an meinem ersten Tag in Israel kennen, denn Avris Bruder hatte einen Gewürzladen, wo Sonnenblumenkerne und Kaffee frisch geröstet wurden. Mit Avri bin ich bis heute befreundet.
ULRICH W. SAHM
Mit einem Geleitwort von Henryk M. Broder
|
|
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit
Sein Buch erlaubt einen tiefen Einblick in das Alltagsleben in Israel. Leser und Leserinnen haben Gelegenheit, aus der Insiderperspektive heraus zu verstehen, was das Leben in diesem nahen und doch so fremden Nachbarland antreibt und hemmt. Dabei stehen Kriegsschrecken neben archäologischen Sensationen, kulinarische Entdeckungen neben politischen Absurditäten. Eine Vielzahl plastischer, oft auch skurriler Beispiele illustriert neben zahlreichen, in jedem Sinne farbigen Abbildungen die Kernbotschaft des Bandes: Nur gemeinsam werden die Bewohner dieser Jahrtausende alten Kulturlandschaft eine Lösung ihrer Probleme finden; Respekt füreinander, Kenntnis voneinander und nicht zuletzt Humor im Umgang miteinander sind wichtige Eckpfeiler in diesem Prozess.
von Compass-Gast-Autor Hans Maaß finden Sie hier:
Rezension
In Köln studierte ich ab 1968 bei Professor Johann Maier und bei dem später ermordeten Dozenten Hermann Greive Judaistik. Zeitweilig war ich auch an der kirchlichen Hochschule in Wuppertal, um Griechisch zu lernen, weil mein Vater der Meinung war, dass ich erst mal den »Brotberuf « des Pastors erlernen solle, ehe ich mich einem schöngeistigen, aber wenig einträglichen Berufsweg wie der Judaistik zuwende. 1970 kehrte ich mit einem Stipendium des Martin Buber-Instituts in Köln nach Israel zurück. Jerusalem, September 2009
Dort wurde ich trotz meiner langen Haare als gewissenhafter und vor allem interessierter Student »entdeckt«. Kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland wurde mir deshalb empfohlen, meine Studien doch in Jerusalem fortzusetzen. Der Gedanke war mir bis dahin gar nicht gekommen und es blieben nur zehn Tage bis zum Semester-Beginn. Ich entschied mich augenblicklich und brach kurzfristig meine Zelte in Deutschland ab. Eine Freundin, Tamar Goldschmidt, eine Enkelin Martin Bubers, übernahm meine Studentenwohnung in Bonn, während ich bei ihren Eltern, Bärbel und Zeev, in Jerusalem eine zeitweilige Unterkunft fand.
Das größere Problem war die Auswahl des Studienganges. »Judaistik« gab es an der Hebräischen Universität genauso wenig, wie eine Fakultät für »Deutschtum« in Deutschland. Ich musste zwischen Bibelwissenschaften, Hebräischer Sprache, Jüdischer Geschichte und sonstigen Hauptfächern auswählen. Ich entschied mich für »Hebräische Literatur«, weil ich mir dachte, dass ich bei diesem Fach ein wenig von allem erfahren würde: Sprache, Kultur, Geschichte, Religion, Theologie.
Von Vorteil war, dass die Universität fälschlich voraussetzte, dass ein ausländischer Student, der sich für »Hebräische Literatur« einschreibt, tatsächlich die hebräische Sprache beherrsche. Zwar hatte ich in den Schulpausen in Paris gesprochenes Hebräisch aufgeschnappt und in Deutschland gleich zweimal das »Hebraicum« absolviert, einmal für Theologen und einmal für Judaisten. Doch zu behaupten, dass ich Hebräisch könne, wäre maßlose Übertreibung gewesen. Gleichwohl wurde ich also von dem Zwang freigesprochen, erst einmal ein Jahr lang die Landesprache zu erlernen und begab mich unverzüglich in die Vorlesungen und Seminare. Bis heute besitze ich das Taschenbuch »Mein Michael« von Amos Oz. Es war das erste hebräische Buch, das ich je gelesen habe. Auf den ersten Seiten notierte ich mit einem Bleistift über jedem zweiten Wort die deutsche Übersetzung. Je weiter ich vorstieß, desto seltener wurden die Bleistifteintragungen.
Ich belegte ein Seminar zu Schmuel Josef Agnon, dem wohl schwierigsten modernen Autor und ersten Nobelpreisträger Israels. Um überhaupt etwas zu verstehen, las ich deutsche Übersetzungen und studierte vor allem die auf Deutsch veröffentlichte Sekundärliteratur. So stieß ich auf einen Aufsatz Gerschom Scholems. Der erwähnte in einem Suhrkamp-Bändchen, dass Agnon 1918 eine Anthologie in deutscher Sprache zum jüdischen Hanukka-Fest herausgegeben habe. Kurz zuvor hatte das Agnon-Archiv der Hebräischen Universität eine Bibliographie aller seiner Werke veröffentlicht. Das von Scholem erwähnte und von mir nun gesuchte Buch war weder im Katalog der Nationalbibliothek noch in der Bibliographie angeführt. In der Nationalbibliothek fand ich es schließlich unter seinem Titel Moaus Zur. Auf der allerletzten Seite war in kaum lesbarer gotischer Schrift erwähnt, dass Agnon der Herausgeber sei. Ich lieh es aus und begab mich zu Rafi Weiser, dem Leiter des Agnon-Archivs. Bei dem wollte ich mich darüber beschweren, dass er offensichtlich die deutsche Vergangenheit des israelischen Nationaldichters zensiert habe. Aber Weiser versicherte mir, keine Ahnung gehabt zu haben und schlug mir vor, einen Artikel über meine sensationelle »Entdeckung« eines unbekannten Werkes des größten israelischen Nationaldichters zu schreiben.
Sehr erstaunt war ich, dass mein von Weiser in vorzügliches Hebräisch redigierter Text wenig später die Feiertagsausgabe des Feuilletons des Haaretz halbseitig schmückte und dass es sogar einen Hinweis auf meine »Entdeckung« auf der Hauptseite gab. Haaretz ist die angesehenste Zeitung Israels, vergleichbar mit New York Times in Amerika oder der FAZ in Deutschland. Eine ungeahnte Wirkung, die mein Zufallstreff er da entfaltete; etwa so, als wäre ein Nigerianer nach Deutschland gekommen, um Germanistik zu studieren, und hätte mangels Sprachkenntnissen ein verschollenes Werk von Goethe entdeckt.
Der Herausgeber des Haaretz, Gustav Schocken, war ein Sohn des legendären Berliner Verlegers Salman Schocken. Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte dieser Agnon »entdeckt« und zu seinem Haus-Autor gemacht hatte. Der Schocken-Verlag musste unter den Nazis in Berlin seine Tore schließen und wurde nach New York und Jerusalem verlegt. Gustav Schocken lud mich in sein luxuriöses Penthouse am »Kikar Hamedina« in Tel Aviv ein und machte mir den Vorschlag, dass ich doch öfter etwas für den Haaretz schreiben solle. Ich war gerade mal 22 Jahre alt, Student, konnte nicht richtig Hebräisch und war sehr geehrt, verstand aber nicht recht, wie er sich das denn vorstellte: »Ich kann doch nicht jede Woche ein verschollenes Buch von Agnon entdecken …« Doch Schocken hatte sich etwas anderes ausgedacht: »Wie wäre es, wenn du für uns Rezensionen neuer deutscher Bücher verfasst?«
Warum nicht? Ich erfuhr, dass Verlage kostenlose Rezensionsexemplare zuschicken. Da ich immer schon viele Bücher um mich hatte, war das eine tolle Chance, meinen Bücherschrank zu füllen. Auch die Vorstellung, für das Lesen von Büchern bezahlt zu werden, war verlockend, zumal die Zuwendungen meiner Eltern nur für das Notwendigste reichten. Als Erstes bestellte ich mir die Lutherbibel von 1545, die gerade in einer wissenschaftlichen Ausgabe in zwei dicken, schweren Bänden erschienen war. Nach dem Coup mit der Agnon-Anthologie war die Besprechung der Lutherbibel mein zweiter Artikel im Haaretz. Dann folgten Werke von Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Günter Grass und eine frisch erschienene Gesamtausgabe meines Lieblingsautors Joseph Roth, der gerade ein Comeback in Deutschland erlebte.
Zu dem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass Schocken mich einsetzte, um ein seit den dreißiger Jahren bestehendes Tabu zu brechen. In der israelischen Presse wurde keine neue deutsche Literatur besprochen. Die Zeit war offenbar reif: Etwa ein Jahr nach meinen ersten Rezensionen gab es in Israel einen »Boom«. Mehrere von mir besprochene Werke wurden ins Hebräische übersetzt. Auch andere israelische Zeitungen bemerkten die Marktlücke. Mosche Schamir, selber ein großer Schriftsteller, leitete damals das Feuilleton der Abendzeitung Maariv und wandte sich an mich mit der Bitte, doch auch für ihn zu schreiben. Mein erster Artikel bei Maariv erschien als Doppelseite im Wochenendmagazin mit vielen Bildern. So führte ich die Israelis in das vergessene Werk des jüdischen Schriftstellers Joseph Roth ein.
Im Zusammenhang mit meiner damaligen Arbeit für Haaretz während des Studiums möchte ich noch ein kleines Erlebnis erwähnen. Mein Vater war vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt als Ministerialdirektor ins Kanzleramt geholt worden. Zuvor schon war er der erste bundesdeutsche Beamte, der jemals Gespräche in der DDR geführt hatte. Er bereitete die sogenannten »Bahr-Gespräche« vor. Weil mein Vater hinter den Kulissen einer der Architekten der Ostpolitik Brandts war, wurde er schließlich als erster Repräsentant dieser neuen westdeutschen Politik als Botschaft er nach Moskau entsandt. Ausgestattet mit einem deutschen Diplomatenpass reiste ich Mitte der siebziger Jahre wiederholt dorthin »nach Hause«. Damals gab es keinerlei diplomatische oder sonstige Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Israel. Nur tröpfchenweise ließen die Sowjets einige Juden über Wien ausreisen, unter dem Mantel der Verschwiegenheit.
Einer meiner Besuche in Moskau fiel auf Yom Kippur, den jüdischen Versöhnungstag. Sascha Brenner, der Wissenschaftsattaché meines Vaters, nahm mich mit in die große Synagoge in der Archipowa-Straße. Als einige der Juden erfuhren, dass ich direkt aus Israel nach Moskau gekommen sei, zog mich einer in eine finstere Ecke, schaute sich um, ob wir von KGB-Spähern beobachtet wurden, zog einen Briefumschlag aus seinem Mantel und übergab ihn mir mit der Bitte, ihn in Israel seinen Verwandten zu schicken. Ein anderes Mal nahm mich Sascha zur Datscha eines Professors außerhalb Moskaus mit. Beim Essen erzählte ich etwas sorglos über Israel. Der Professor zeigte aufgeregt an die Decke und legte seinen Finger auf den Mund. So brachte er mich zum Schweigen, aus Angst, abgehört zu werden. Ehe er einen Spaziergang durch die Birkenwälder vorschlug, außerhalb seiner mutmaßlich mit Abhörgeräten bestückten Datscha, entschuldigte er sich noch, dass es in seiner Toilette kein Klopapier gebe. Das sei gerade knapp in der sowjetischen Weltmacht. Während des Spaziergangs wollte er dann ganz genau wissen, wie die Chancen für einen Akademiker seien, in Israel Arbeit zu finden, und ob tatsächlich alle Israelis in bitterer Armut lebten, wie es die sowjetische Propaganda darstelle. Erst jetzt kapierte ich, warum Sascha mich mitgenommen hatte.
Solche und andere Erlebnisse schrieb ich auf Hebräisch auf und bat meinen Vater, den Umschlag mit deutscher Diplomatenpost umgehend nach Israel zu schicken. Die Zeitung Haaretz veröffentlichte alle meine Artikel, ohne meinen Namen zu nennen. So war ich für die Zeit meines »Heimaturlaubs« in Moskau zum anonymen Korrespondenten des Haaretz in der Sowjetunion avanciert. Sascha Brenner wurde übrigens später zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Berlin gewählt.
Es sei noch ein Besuch meines Vaters in Israel erwähnt. Ehe er kam, bat er mich, Besuche bei seinen alten Freunden, z.B. bei Ascher Ben Natan, dem ersten israelischen Botschaft er in der Bundesrepublik, zu organisieren. Gleichzeitig wollte aber auch ich mit meinen Kontakten protzen und informierte Gustav Schocken über den bevorstehenden Besuch des deutschen Botschafters in Moskau. Beim Abendessen, zu dem er uns einlud, kam dann »ganz zufällig« ein Überraschungsgast vorbei, der viele Fragen zur Sowjetunion und ihren politischen Absichten hatte: Es war der Herr Verteidigungsminister persönlich, ein gewisser Schimon Peres …
Die folgenden Seiten sind prall gefüllt mit weiteren Erlebnissen und Ereignissen aus meinen 40 Jahren Israel: Dabei stehen Kriegsschrecken neben archäologischen Sensationen, kulinarische Entdeckungen neben politischen Absurditäten, Anekdoten aus dem 20. Jahrhundert neben Interviews aus dem 21. Die Kernbotschaft aber lautet: Nur gemeinsam werden die Bewohner dieser Jahrtausende alten Kulturlandschaft eine Lösung ihrer Probleme finden; Respekt füreinander, Kenntnis voneinander und nicht zuletzt Humor im Umgang miteinander sind wichtige Eckpfeiler in diesem Prozess.
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
Ein Blick zurück Jerusalem, im Januar 2010
Seit ich den Nahen Osten 1968 zum ersten Mal besucht habe, haben sich das Land und die Menschen grundlegend verändert. Im Rückblick waren es Kriege und Friedensschlüsse, Einwanderungswellen, Terroranschläge und Ereignisse wie der Mord an Ministerpräsident Jitzhak Rabin, die in gespenstischer Geschwindigkeit auch die eigene Haltung und Sicht auf Israel immer wieder von Neuem in Frage stellten.
Das wohl aufregendste Erlebnis war für mich auch der Beginn meiner journalistischen Arbeit: die Ankunft des ägyptischen Präsidenten Anwar el Sadat auf dem Ben Gurion-Flughafen bei Tel Aviv am 19. November 1977. Das war der Höhepunkt meiner Friedenserwartungen, vermischt mit Vernichtungsängsten, die ich kurz zuvor während des Yom Kippur Krieges von 1973 ebenfalls miterlebt hatte. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich alles, was davor und danach passierte, Krieg und Frieden. Blinder Euphorie folgten Abgründe der Enttäuschung, Ernüchterung und Verzweiflung.
Das färbt auch auf das eigene Selbstverständnis ab. Journalisten müssen einen kühlen Kopf behalten, wenn sie als neutrale Beobachter über historische Ereignisse berichten wollen und nicht als Beteiligte. Das erfordert Distanz zu den Personen und Vorgängen sowie Selbstkritik –Journalisten wird deshalb oft Zynismus unterstellt.
Nicht jedes vermeintlich historische Ereignis hat wirklich die ihm zugeschriebene Tragweite. Manchmal können ganz nebensächliche Ereignisse von größter Bedeutung sein. Wer hätte gedacht, dass ein Autounfall im Dezember 1987 einen Dauerkrieg zwischen Israel und den Palästinensern auslösen könnte, der zur gegenseitigen Anerkennung von Israel und der PLO und der Rückkehr Jassir Arafats führen würde.
Umgekehrt: Selbst der »historische« Besuch von Anwar el Sadat damals 1977 in Israel beendete keineswegs die Feindseligkeit zwischen der arabischen Welt und dem jüdischen Staat.
Immer wieder musste ich erfahren, dass es keine absolute Wahrheit gibt und auch keine Zauberlösungen für den Nahostkonflikt. Heute ist es Mode, die israelischen Siedlungen und die Besatzung als letztes verbliebenes Friedenshindernis zu sehen, nicht aber Judenhass, Antisemitismus und eine Verweigerung des Existenzrechts Israels auf der arabischen Seite. Frieden auf Erden werde ausbrechen, sobald die Formeln »Land für Frieden« oder »Zwei Staaten für zwei Völker« erfüllt sind. Ich glaube nicht mehr an solch simple Dogmata. Sie sind längst nicht so selbstverständlich, wie sie klingen.
Aber wer mich dann auffordert, »bessere« Lösungen vorzuschlagen, wird von mir keine Antwort erhalten.
Nachdem dreitausend Jahre lang, also seit Menschengedenken – im wortwörtlichen Sinne – das gelobte Land nie richtig zur Ruhe gekommen ist, mag ich nicht daran glauben, dass hier in ein paar Monaten oder Jahren alle Probleme gelöst sein könnten.
Zu den schwierigsten Kapiteln der Neuzeit gehören der Holocaust und die Gestaltung der Beziehungen zwischen Deutschen und Juden. Doch selbst bei diesem Th ema funktioniert keine Schwarz-Weiß-Malerei, wie die für dieses Buch ausgewählten Anekdoten und Erlebnisse zeigen.
Nach vielen Jahren in Nahost habe ich gelernt, dass nichts wirklich so ist, wie es zu sein scheint. Es gibt keine lineare Entwicklung, sondern eher eine Folge von immer neuen Zerreißproben mit ungewissem Ausgang. Aus diesem Grund habe ich es aufgegeben, mir eine eigene politische Meinung zu leisten und mit festgefahrener Ideologie genau zu wissen, wo es lang geht oder was der einzige denkbare Weg zur Glückseligkeit, also zum Frieden im Nahen Osten ist. Gleichwohl kann jeder mit kleinen Schritten und winzigen Gesten ganze Berge versetzen.
von Compass-Gast-Autor Hans Maaß finden Sie hier:
Rezension
Der Autor
Kontakt zu COMPASS und/oder dem Autor:

1950 in Bonn als Sohn eines deutschen Diplomaten geboren. Aufgewachsen in London, Paris, Bonn, Heppenheim (1968 Abitur an der Odenwaldschule), Moskau und Ankara. Studium der evangelischen Theologie, Judaistik und Linguistik in Bonn, Köln und an der kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Ab 1970 Studium der Hebräischen Literatur an der Hebräischen Universität in Jerusalem.
Seit 1975 Nahost-Korrespondent für deutsche Medien mit Sitz in Jerusalem
redaktion@compass-infodienst.de