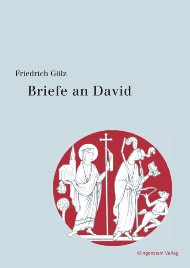ONLINE-EXTRA Nr. 125
© 2010 Copyright bei Autor und Verlag
Im Jahre 2003 beginnt der Theologe und Pfarrer Friedrich Gölz Briefe an seinen Enkel David zu schreiben. Briefe, die von einer langen Reise berichten, der Reise eines Christenmenschen zu den Wurzeln seines Glaubens, dem Judentum. Am Ende wurden es 22 Briefe, sehr persönliche Schreiben, tiefgehende Überlegungen zu "der immer schon belasteten Beziehung zwischen Judentum und Christentum", Briefe, in denen er nicht nur versucht, seinem Enkel viele verschiedene Aspekte des Judentums nahe zu bringen, sondern die zugleich eine bisweilen vorsichtig tastende, bisweilen im besten Sinne des Wortes radikale Selbstvergewisserung der eigenen christlichen Existenz im Angesicht von Auschwitz darstellen. In sanftem und dennoch eindringlichen Ton erzählt er von jüdischen und christlichen Persönlichkeiten, denen er auf seiner Reise begegnete und die sein Denken entscheidend mitprägten, anschaulich erklärt er seinem Enkel die verschiedenen Strömungen innerhalb des Judentums, setzt sich mit der unheilvollen Geschichte von Kirche und Theologie im Verhältnis zu Juden und Judentum auseinander und kommt immer wieder auch auf den Nahost-Konflikt zu sprechen. Treffend heißt es in einer Rezension über den Charakter des so entstandenen Buches:
"Es sind keine distanzierten theologischen oder historischen Abhandlungen. Der Leser wird vielmehr hineingenommen in das Denken, ja das Ringen eines von wesentlichen Fragen umgetriebenen, sensiblen Theologen, Pfarrers und Zeitgenossen. Das persönliche Engagement, die biographische Verankerung, das Teilhaben an der Entwicklung seines Denkens und Empfindens, das ist es, was diese Briefe so lesenswert macht und den Leser herausfordert, eigene, lieb gewordene Positionen zu überdenken."
Das heutige Online-Extra präsentiert vier der 22 "Briefe an David", die Ihnen einen exemplarischen Eindruck von Stil und Inhalt der "Briefe an David" geben. Und wenn Sie davon animiert auch die restlichen 18 Briefe lesen möchten, können Sie das vollständige Buch als pdf-Datei herunterladen. Aufgrund einer sogenannten "Creative Commons Lizenz", die der Klingenstein-Verlag, in dem die "Briefe an David" 2008 als Buch erschienen, veranlaßt hat, steht das Buch zur nicht-kommerzielle Nutzung als pdf-Datei zur Verfügung.
COMPASS dankt dem Autor und dem Verlag für die Veröffentlichung der Texte an dieser Stelle!
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 125
Es sind echte Briefe eines Großvaters an seinen Enkel, die ich hier vorlege. Ich schrieb sie zwischen November 2003 und April 2005. Mit ihnen wollte ich nicht zuletzt mir selbst Klarheit über eine Veränderung meines eigenen Denkens verschaffen, die ich seit vielen Jahren spüre.
Zeitpunkte und Inhalte der Briefe ergaben sich oft zufällig. Der Zusammenhang wurde mir manchmal erst hinterher ganz deutlich. Darum verzichte ich jetzt auf eine durchgreifende, glättende Bearbeitung. Denn nicht eine Position wollte ich schildern, sondern von einem Weg wollte ich erzählen, auf dem David, damals noch Schüler, mich ein Stück weit zu begleiten bereit war.
So wünsche ich mir als Leser nicht nur jüngere Menschen, sondern auch Altersgenossen, Eltern und Großeltern zum Beispiel, die nach einer Klärung der immer schon belasteten Beziehung zwischen Judentum und Christentum suchen und die zu den hier aufgeworfenen Fragen – auch zu der nach Israels Rolle im „Nahost-Konflikt“ – noch keine fertigen Antworten vorweisen können.
Der so genannte Jüdisch-Christliche Dialog darf sich nicht im Austausch von unverbindlichen Freundlichkeiten erschöpfen. Er sollte auch nicht begrenzt bleiben auf den Kreis weniger Spezialisten.
Verwandte, die einander so lange schon und so gründlich fremd geworden sind, werden sich nur näher kommen können, wenn sie sich frei halten von einem offenen oder versteckten Interesse an „Besitzstandswahrung“. Wir sollten bereit werden, ein gängig-einseitiges Geschichtsbild zu überdenken, auch eigene Positionen und lieb gewordene Gewohnheiten (sprachlicher, politischer, dogmatischer Art) zu korrigieren.
Deshalb träume ich von einer Christenheit, die ihre Herkunft gründlicher bedenkt, ihr Versäumen erkennt und bereit wird, da und dort aus dem Gewordenen und Gewohnten aufzubrechen. Nur so wird sie ihre jüdische Mutter neu und in Liebe entdecken können.
Frieder Gölz
Im April 2008![]()
Stuttgart, am 25. November 2003 vor einiger Zeit erzählte ich Dir, dass ich mich schon seit Jahren mit der Geschichte der deutschen Juden beschäftige. Ziemlich erstaunt hast Du mich da angeschaut. Offenbar warst Du der Meinung, es gebe doch andere, viel interessantere und aktuellere Themen, die zu studieren sich für einen Großvater lohnen könnten. Das will ich nicht bestreiten. Aber weil ich nun einmal an jenem Dir sicher seltsam erscheinenden Thema hängen geblieben bin, würde ich Dir gerne in einigen Briefen von meinen Altersstudien berichten. Natürlich habe ich dabei die Hoffnung, dass diese Briefe auch Dein Interesse für mein Thema wecken könnten. Er lebte an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Berlin und war bei Juden und Christen als fortschrittlicher Mann bekannt. Sein Lehrer und Vorbild war der ob seiner Weisheit berühmte Moses Mendelssohn gewesen. Und David Friedländer wollte nach dem Tod seines Meisters dessen Reform-Werk fortsetzen und vollenden. An einem „Offenen Brief“, den dieser David vor 205 Jahren geschrieben und durch den er damals bei Juden und Christen einige Aufregung verursacht hat, will ich aufhängen, was ich Dir erzählen möchte. So, wie man ein großes Bild an einem Nagel aufhängen kann. Denn eigentlich reicht mein Thema recht weit über jene vorvorletzte Jahrhundertwende hinaus. Es geht zurück bis ins Altertum und wirkt bis in unsere Gegenwart hinein. »Lieber Frieder, wie könnt Ihr denn nur so unvorsichtig sein, Euren Enkelkindern jüdische Namen zu geben!« Verstehst Du, warum sich meine Freundin Trude K. um Deinen Vornamen sorgte? Sie befürchtete, dass ein „jüdischer“ Name einem Christen im heutigen Deutschland nachteilig werden könnte. Solche Befürchtungen wollte jener Berliner David schon vor 200 Jahren im Voraus und für alle Zukunft unmöglich machen. Dass und warum ihm dies nicht gelungen ist – auch davon wird zu berichten sein.
Lieber David,
Nun wirst Du fragen: Warum denn gerade „Briefe an David“? Mir ist ein anderer, ein jüdischer David begegnet, mit dem ich Dich bekannt machen will. Sein Bild hast Du vielleicht neulich im Berliner Jüdischen Museum gesehen:
David Friedländer
Was ich über diesen anderen David und über die lange Geschichte, in welcher er eine gewisse Schlüsselrolle spielte, gelesen und bedacht habe, das will ich also in diese „Briefe an David“ fassen. Ich hatte mir als Leser und Zuhörer jemanden gewünscht, den ich kenne und mag – und der dann vielleicht auch einmal auf diese Briefe reagieren, mir durch Rückfragen zu weiterer Klärung verhelfen könnte. So frage ich Dich, lieber Enkelsohn: willst Du Dich darauf einlassen? Könntest Du diese Briefe freundlich in Empfang nehmen, sie durchlesen und aufbewahren? Letzteres für den Fall, dass entweder Du selbst oder ein anderer Leser von meinem Interesse für das Schicksal der Deutschen Juden angesteckt wird.
Warum ausgerechnet Du mir als Empfänger eingefallen bist? Erstens deshalb, weil Du ja unter unseren Enkeln immer schon der eifrigste Leser gewesen bist. Ein zweiter Grund: Als Du im April 1987 geboren wurdest, habe ich dieses freudige Ereignis einer jüdischen Freundin, die in Israel lebt, mitgeteilt. Und sie schrieb mir offensichtlich erschrocken zurück:
Weil ich auch diesen anderen David inzwischen ins Herz geschlossen habe, kommt jetzt mein „Erster Brief an David“ zu Dir. Ich hoffe, dass er Dich ein wenig neugierig macht, und schicke Dir einen herzlichen Gruß!
Dein Großvater ![]()
Stuttgart, am 04. Dezember 2003 Du fragtest, warum sich eigentlich meine israelische Freundin darüber aufgeregt hat, dass meine Enkel „jüdische Namen“ erhielten. Das liegt bestimmt nicht daran, dass die Juden ihre Namen für sich allein behalten möchten. Sie wissen, dass wir Christen die jüdische Bibel, das so genannte „Alte Testament“ mit ihnen gemeinsam haben. Richtiger ausgedrückt: Wir Nichtjuden haben die Bibel, ein durch und durch jüdisches Buch, von ihnen empfangen. Auch das „Neue Testament“, welches in all seinen Teilen von Juden geschrieben wurde. Aber Trude K., sie ist etwas älter als ich, entkam damals, als sie etwa so alt war wie Du jetzt bist, nur mit knapper Not aus Deutschland. Ihre Angehörigen wurden alle ermordet. Falls Du den Roman „Exodus“ oder den Film dazu kennst, kannst Du Dir vorstellen, was Trude in ihrer Jugend erlebt und erlitten hat.
Lieber David,
Sie war als Tochter einer frommen jüdischen Familie in Meiningen (Thüringen) aufgewachsen. Als Kind und als junges Mädchen hatte sie sich ganz als Deutsche gefühlt. Sie war eine sehr gute Schülerin und wollte gerne Lehrerin werden.
Aber dann kam während ihrer Schulzeit dieser Sturm auf, der alle in Deutschland lebenden Juden zu verhassten Fremden machte. Diese Klimavergiftung ist ja nicht im Jahr 1933 mit Hitler aus heiterem Himmel wie ein plötzliches Gewitter über Deutschland hereingebrochen. Sie war das schreckliche Ergebnis einer langen gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Vaterland.
Was in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938, der so genannten „Kristallnacht“, in Deutschland geschehen ist, das weißt Du. Trude lebte damals als junge Lehrerin in Duisburg. Nur in einer jüdischen Schule durfte sie noch unterrichten. In jener Nacht aber wurde mit der benachbarten Synagoge auch diese Schule niedergebrannt. Noch im November konnten Lehrer einen Teil der Schüler über die Grenze nach Holland bringen. Von dort aus haben holländische Helfer diese Kinder, deren Eltern vielfach schon im Konzentrationslager waren, nach England in Sicherheit gebracht. Trude kam mit anderen Schülern zu einer Sammelstelle nach Hamburg, wo sie 14 bis 17-jährige Kinder auf die erhoffte Auswanderung nach Palästina vorbereiten half. Diese jüdischen Kinder mussten dann kurz vor Kriegsausbruch dem Nazistaat regelrecht abgekauft werden.
Auf einem alten, mit etwa 1000 Kindern und Jugendlichen total überfüllten Schiff konnte Trude noch im Jahr 1940 als Betreuerin von Wien aus die Donau hinunter und an der Türkei vorbei Richtung Palästina fahren. Schon diese lange Reise in Angst und drangvoller Enge war, so erzählt sie, einfach grauenhaft. Als sie schließlich vor der Küste Palästinas ankamen, wollte die zuständige englische Mandats-Regierung aus Sorge vor Unruhen keine Juden mehr in das Land hereinlassen. Das Schiff hieß ironischerweise Patria, auf deutsch also „Vaterland“. Alle auf der Patria zusammengepferchten Jungen und Mädchen waren aus dem Land entkommen, das sie doch immer für ihr Vaterland gehalten hatten. Dort waren sie verfolgt und tödlich bedroht gewesen. Und jetzt wurde ihnen auch der Zugang zum Vaterland ihrer Vorfahren verweigert. Tagelang lag die Patria mit all den jungen aus Deutschland entronnenen Juden in der großen Bucht vor der Stadt Haifa. Es hieß, die jüdischen Flüchtlinge müssten nach Deutschland zurück, vielleicht würden sie auch vorläufig nach Madagaskar abgeschoben. Panik brach aus und die Schiffsleute beschlossen, das Schiff im Hafenbecken zu versenken, um eine Weiter- oder gar Rückfahrt unmöglich zu machen. 260 Jugendliche sind nach der Explosion, für die man die falsche Sprengstoffmenge eingesetzt hatte, ertrunken. Die anderen, darunter auch Trude, konnten sich schwimmend an Land retten.
Nach Jahren großer Unsicherheit und Angst begann sich Trude, so sagt sie, in Palästina ein bisschen sicher zu fühlen. Aber nicht für lange. Denn die jüdischen Einwanderer, deren Zahl zunahm, waren dort nicht willkommen. Von Sicherheit konnte keine Rede sein. Eigentlich bis heute nicht …
Aber nach dem Krieg und nach der Gründung des Judenstaates (1948) ist Trude mit ihrem Mann gelegentlich wieder nach Deutschland gekommen. Herbert K. hatte ein ähnliches Schicksal erlitten wie sie; auch seine Angehörigen waren im KZ ermordet worden. Dass Familie K. inzwischen wieder deutsche Freunde hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Denn Du kannst Dir denken, dass in solchen Juden nach den Jahren der Angst und der Flucht und durch die Erinnerung an ihre ermordeten Angehörigen ein tiefer Widerwille. gegen die Deutschen und gegen alles Deutsche steckte. Und in Trude wohnt immer noch eine Art Misstrauen, vielmehr ein Grundgefühl für die Verschiedenheit zwischen Juden und Christen, für die uralte Feindschaft, welche, so fürchtet sie, in Deutschland immer einmal wieder mobilisiert werden könnte. Außerdem begleitet sie die Trauer durchs Leben, weil ihre Eltern nicht gleich nach Hitlers Machtergreifung aus Deutschland geflohen sind. Während der ersten Jahre des „Dritten Reiches“ wäre das unter Zurücklassung ihrer Habe noch möglich gewesen. Aber als angesehene jüdische Bürger waren sie, trotz Hitlers „Machtergreifung“, ganz sicher gewesen, dass sie schlimmstenfalls ein bisschen vorübergehenden antisemitischen Nazi-Krawall zu befürchten hätten. Aber nichts Lebensbedrohendes. So gründlich haben sie, haben viele Juden das bejubelte „neue Deutschland“, also auch den dann bald zur Hochglut geschürten Juden-Hass unterschätzt!
Aus diesen Erfahrungen stammt also Trudes Verdacht, dass es doch niemals gut sein könnte, wenn man in Deutschland einen jüdischen Namen trägt. Und als ich ihr begeistert berichtete, mein neugeborener Enkelsohn heiße David, ist dieser Affekt („Wie könnt Ihr ihm nur einen jüdischen Namen geben!“) wieder hoch gekommen. Als Deine Schwester Mirjam geboren wurde, hat sie, darüber bin ich froh, nichts dergleichen gesagt.
Nebenbei können Dir solche Lebensgeschichten wie die von Trude erklären, warum viele Israelis dieser älteren Generation ziemlich stur sind und im Umgang manchmal etwas schwierig. Hier in Deutschland wird ja heutzutage die Politik des Staates Israel vielfach schnell und harsch verurteilt. Viele schimpfen gerne auf „diese unmöglichen Israelis“, die auf arabische Feindseligkeiten zuweilen recht scharf reagieren. Wer aber ein wenig begreifen kann, mit welchen Enttäuschungen und Verletzungen, mit welch schlimmen Erinnerungen viele Juden dort leben müssen, der wird in seinem Urteil über den politischen Kurs Israels vorsichtiger sein.
Was das alles nun mit jenem anderen David zu tun hat, der Friedländer hieß? Von ihm und von seinem geschichtlichen Umfeld möchte ich Dir ja in den folgenden Briefen erzählen. Schon zu seiner Zeit hat sich nämlich die Entwicklung vorbereitet, welche dann während meiner Jugendzeit ihren trostlosen Tiefpunkt erreichte und für ungezählte Juden in der Katastrophe endete.
Wer das sehen und verstehen will, warum sich im 19. Jahrhundert das böse Gift des Antisemitismus so ausgebreitet und in die Herzen der meisten Deutschen hineingefressen hat, der muss allerdings weit über David Friedländers Lebenszeit hinausgreifen. Nach vorn und nach hinten. Wir könnten uns zum Beispiel im Vorbeigehen noch an zwei weitere Davids erinnern: Beide haben im Abstand von fast dreitausend Jahren einen jüdischen Staat gegründet. Und weil jetzt dann bald die Weihnachtszeit ist, in der all die schönen Lieder gesungen werden, erinnere ich Dich auch daran, dass man den Juden, dessen Geburt die Christen am Christtag feiern, oft den „Sohn Davids“ genannt hat.
Du siehst: das Terrain, auf dem ich mich gerne in Deiner Begleitung hin und her bewegen möchte, ist ziemlich weiträumig. Man braucht für so weite Wege Geduld und eine gute Puste. Die wünsche ich Dir und mir.
Herzlich grüßt Dich Dein Großvater
FRIEDRICH GÖLZ
Briefe an David
Briefe an David
Die hier kostenlos als vollständige Fassung angebotenen "Briefe an David" können zur nicht-kommerzielle Nutzung als pdf-Datei heruntergeladen werden. Dies geschieht auf Grundlage einer Creative Commons Lizenz. Nähere Informationen erhalten Sie hier.
Es sind keine distanzierten theologischen oder historischen Abhandlungen. Der Leser wird vielmehr hineingenommen in das Denken, ja das Ringen eines von wesentlichen Fragen umgetriebenen, sensiblen Theologen, Pfarrers und Zeitgenossen. Das persönliche Engagement, die biographische Verankerung, das Teilhaben an der Entwicklung seines Denkens und Empfindens, das ist es, was diese Briefe so lesenswert macht und den Leser herausfordert, eigene, lieb gewordene Positionen zu überdenken.
in Württemberg; Ausgabe 23, 1. Dezember 2008)
Stuttgart, am 01. August 2004 die Landkarte von Israel/Palästina bekommen wir in den Medien ja oft zu sehen. Weißt Du, wo auf dieser Karte die Stadt Haifa zu suchen ist? Dort, wo die Küstenlinie in einer Art Bergnase ins Mittelmeer hineinragt, findet sich der Hafen und die große Bucht mit dieser wohl schönstgelegenen Stadt des Landes. Wie eine große Arena breitet sich Haifa im Halbkreis, geöffnet zum Meer hin. Am herrlichsten zeigt sie sich den Besuchern von oben, wo das Karmel-Gebirge jene „Nase“ bildet. Mit vielen Besuchergruppen bin ich dort oben gestanden und habe hinunter gestaunt.
Lieber David,
Lass Dir erzählen, was mir noch einfällt, wenn ich an diese wunderschöne Stadt denke: Werner Neufließ, von dem ich Dir im vorletzten Brief erzählte, ist in Haifa gestorben. Man hat ihn nach seinem schweren Schlaganfall noch in ein dortiges Pflegeheim gebracht. So konnte ihn seine Tochter, die in Haifa wohnt, auf seinem letzten Wegstück begleiten.
In der Bucht von Haifa lag auch das Schiff, mit dem Trude ins Land kommen wollte. Erinnerst Du Dich? Es musste versenkt werden, weil die Engländer damals keine Juden mehr, auch keine der tödlichen Bedrohung gerade noch entronnenen Juden ins Land lassen wollten. Trude lebt jetzt in einem Vorort von Haifa im Altersheim. Sie lässt Dir übrigens einen Gruß bestellen!
In der Oberstadt Haifas befindet sich das Heiligtum der Bahai: Ob Du schon von dieser Religion (manche sagen: „Sekte“) gehört hast, die in sich alles Gute aus Islam, Christentum und Judentum vereinen will? Überhaupt scheint in Haifa ein besonders friedliches Klima zu herrschen. Immer wieder las und hörte ich, dass es dort fast keine Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen gibt. Araber und Juden, auch Christen leben da freundschaftlich beieinander. Ich hoffe, dass das auch heute noch und weiterhin der Fall ist.
Oben am Berghang, also im „besseren Viertel“ der Oberstadt war noch ein anderer, ein für mich wichtiger David zu Hause, der nach dem zweiten Weltkrieg ungezählten schwäbischen Israelbesuchern ein ausgezeichneter Reiseführer gewesen ist. Dass er, der im KZ von Deutschen vielfach gequält und erniedrigt worden war, nun nach dem Krieg mit deutschen Gruppen durchs Land Israel reisen, vielen von ihnen gar ein guter Freund werden würde, darüber hat er sich selbst am meisten gewundert. Bei David Eres und seiner Frau Zippora habe ich während des Golfkrieges (1991) wunderbare Gastfreundschaft genossen. Und er war einer der israelischen Freunde, mit denen ich – bei herzlicher Freundschaft – politisch gar nicht einig werden konnte. Davon wird vielleicht noch zu erzählen sein.
Auch von den „Templern“ könnte ich Dir berichten. Das waren schwäbische Landsleute, Christen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach „Palästina“ auswanderten, um dort auf das von Jesus verkündigte, kommende Reich Gottes zu warten und ihre Vorstellungen von einer erneuerten Gesellschaft zu verwirklichen.
Die Bergnase, unter der sich die herrliche, weite Haifa-Bucht zum Meer breitet, ist das Ende des Karmel-Gebirgszugs. Dieses kleine Gebirge mag Dir aus dem Religionsunterricht bekannt sein. Die Bibel erzählt einmal, dass der Prophet Elia während einer sehr kritischen Zeit das Volk Israel auf dem Karmel versammelt habe und dort ein Gottesurteil herbeiführen konnte: Was die Priester des kanaanäischen Gottes Baal nicht vermochten, das geschah aufs Gebet Elias hin: Feuer fiel vom Himmel, verzehrte das Opfer und überzeugte die Israeliten aufs Neue von der Wahrheit des Väterglaubens. Der Schluss dieser biblischen Geschichte (1. Königsbuch Kap. 18) ist ziemlich grausig: Elia habe in einem Strafgericht 400 Priester des falschen Gottes Baal getötet. An solchen biblischen Geschichten nehmen manche meiner friedensbewegten Mitchristen, wie Du Dir denken kannst, heftig Anstoß.
Auf diesem Karmelgebirge, hoch über der schönen Stadt, die es zur Zeit des Propheten Elia, im neunten vorchristlichen Jahrhundert natürlich noch nicht gegeben hat, liegt inzwischen das Stammkloster des großen katholischen Mönchsordens der „Karmeliter“. Und von einem, der bis vor einigen Jahren dort als Mönch gelebt hat, möchte ich Dir jetzt berichten. Ich bin ihm leider persönlich nur einmal kurz begegnet und finde, er sei wohl einer der interessantesten Menschen gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat im jüdischen Staat suchten und fanden.
Dies war in kurzen Zügen sein spannender Lebensweg:
Oswald Rufeisen ist 1922 in Polen, nicht weit von Auschwitz, als Sohn jüdischer Eltern geboren und dort bis zum Abitur zur Schule gegangen. Schon als Jugendlicher hatte er sich einer zionistischen Jugendgruppe angeschlossen.
Siebzehnjährig erlebt er den Einmarsch der deutschen Truppen in Polen. Er flieht zunächst mit den Eltern. Als die Eltern nicht mehr weiter laufen können, schicken sie die beiden Söhne weiter. Die Brüder werden ihre Eltern nie wieder sehen. Sie kommen nach abenteuerlicher Flucht schließlich nach Wilna. Dort haben sich damals viele aus Osteuropa geflohene Juden gesammelt. Der jüngere Bruder Rufeisen kann einen der begehrten Plätze in einem Jugendtransport nach Palästina bekommen. Oswald schlägt sich mit Mühe und Geschick weiter durch, meist unter Lebensgefahr. Inzwischen war der deutsch-russische Krieg ausgebrochen. Wie bei einer Treibjagd werden Juden zwischen und hinter den Fronten gejagt. Er gerät in Gefangenschaft und kann entfliehen, überlebt Razzien und Misshandlungen, arbeitet eine Zeitlang als Schuster für die Gestapo. Dort hört er von bevorstehenden Massenerschießungen.
Er versteckt sich auf einem litauischen Bauernhof. Als er dort gewarnt wird, beschließt er, den gelben Stern, den er als Jude ja tragen musste, einfach abzutrennen, nach Weißrussland hinein zu fliehen und sich dort als Pole auszugeben. Weil er fließend deutsch, polnisch und russisch spricht, wird er von den Deutschen als Dolmetscher angestellt.
»In dieser Nacht«, schreibt er später, »habe ich mich entschlossen, mitzugehen und alles zu tun, um zu retten, Juden und Nichtjuden, jedem dem ich helfen könnte. Ich war damals 19 Jahre alt. Nun fühlte ich mich wieder als Mensch. Vorher war ich ein gejagtes Tier, aber jetzt, wo ich die Möglichkeit sah, meinem Volk zu helfen, fand ich meine Würde als Mensch wieder.«
Bald wird er dem deutschen Kommandeur ein schier unentbehrlicher Sekretär. Man hat ihn in eine schwarze Polizeiuniform gesteckt, und in der Stadt Mir (westlich von Minsk) gilt er als Mitglied der Besatzungstruppe, bzw. der Gestapo. Er erlebt Schreckliches und kann doch manches verhindern, indem er die Opfer warnt, schließlich sogar Waffen ins Ghetto schmuggelt. Da erfährt er zufällig von dem Beschluss der Deutschen, das Ghetto zu „liquidieren“. Er kann die dortigen Juden noch warnen. Um ihnen etwas Zeit für die Flucht zu verschaffen, überredet er die deutschen Soldaten durch einen Trick zur Jagd auf Wildgänse. So können noch einige Hundert jüngere Juden aus dem Ghetto in die Wälder entkommen. Rufeisen selbst muss aber, weil er verraten wird, fliehen und kann sich in einem Nonnenkloster verstecken. Als die Deutschen dieses Kloster später räumen lassen, entkommt er, als Nonne verkleidet. In seinem Versteck hatte er im Neuen Testament gelesen, und die Gestalt des Juden Jesus wird ihm zur Leitfigur seines Lebens. Er beschließt in dieser Zeit, sich taufen zu lassen. Für kurze Zeit findet er Unterkunft und Arbeit, dann muss er wieder in die Wälder fliehen, wo er sich einer Partisanengruppe anschließen kann. Erst als die Rote Armee die Deutschen Truppen zurücktreibt, kann er wieder auftauchen.
Nach dem Krieg wird Oswald Rufeisen Zeuge in Prozessen gegen Kollaborateure. Weil er ein Mensch ist, der immer ganz und konsequent tut, was er für richtig hält, geht er zurück nach Polen und studiert katholische Theologie, um Priester zu werden. Bei der Taufe hatte er den Vornamen Daniel angenommen. Warum? Weil die Bibel bekanntlich von einem Propheten Daniel erzählt, der in der Löwengrube von Engeln bewahrt wird. So sieht er es als wunderbare Bewahrung an, dass er all das Grauenhafte überleben konnte. Und er fragt sich, wozu er wohl überlebt habe …
In den Fünfziger Jahren reist er nach Israel, um dort seinen Bruder und alte Zionistenfreunde, auch Überlebende aus Mir zu treffen. Er hatte ja nie vergessen, dass er Jude war, und wollte gewiss auch als getaufter Christ Jude bleiben. Israel wird seine neue Heimat; schon als zionistischer Jugendlicher hatte er dieses Land zum Ziel gewählt. So tritt er als Mönch in das Karmeliter- Kloster hoch über der Stadt Haifa ein. Und bald darauf wird er zu einem „Fall“, der die israelischen Behörden und die dortige Öffentlichkeit jahrelang beschäftigt.
Denn schon bei seiner Gründung hatte sich der Staat Israel ein Gesetz gegeben, nach welchem jeder Jude, der in Israel einwandern will, dort automatisch als Staatsbürger anerkannt wird. Denn dazu war der Judenstaat bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden, dass jeder Jude, woher er auch kommt, dort ein Heimatrecht haben sollte. Und auf dieses ihm zustehende Recht beruft sich also auch der Einwanderer Oswald bzw. Daniel Rufeisen. Es wird ihm aber vom Innenministerium mit der Begründung verweigert, er sei doch kein Jude mehr. Dabei beruft sich das Ministerium zwar zunächst auf die alte jüdische Zugehörigkeitsregelung: als Jude gelte jeder Mensch, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Richtig: Jude werde man also normalerweise durch Geburt. Und darauf hatte sich Rufeisen verlassen. Aber die israelischen Behörden urteilen noch nach einer anderen, neueren Regel: dass ein Jude, der sich taufen lässt und also zum Christentum konvertiert, jenes automatische Recht auf Einwanderung im Judenstaat verliere. Auf diese Bestimmung bezog sich schließlich auch der oberste israelische Gerichtshof, als er mehrheitlich entschied, Rufeisen könne zwar in Israel leben, man wäre auch bereit, ihm aufgrund seiner Verdienste die Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu verleihen. Aber als Jude könne er eigentlich nicht gelten und anerkannt werden. Denn vom Judentum habe er sich durch die Taufe getrennt.
Ich weiß, lieber David, dass das alles in Deinen Ohren ziemlich komisch, wenn nicht gar ein wenig verrückt klingt. Aber hinter jener einschränkenden Regel, die den getauften Juden ihr volles Judesein abspricht, regt sich die uralte, tiefe Verletztheit des von getauften Christen immer nur verachteten und gedemütigten, oft genug grausam und tödlich verfolgten Volkes. Obwohl es sich bei der Taufe um einen ursprünglich jüdischen Ritus handelt, gilt bei den Juden die Regel: Wer sich taufen lässt, der will sich vom Judentum trennen und wird deshalb als ein „Abtrünniger“ angesehen. Ein Jude kann zwar glauben, was er will: an einen Gott oder auch an gar nichts. Seine Gesinnung, sein Verhalten ändern nichts an der durch Geburt begründeten Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Selbst einem jüdischen Gottesleugner – und das gibt es gar nicht selten! – wird das Judesein keineswegs bestritten. Übrigens: Auch wer zum Judentum übertritt, gilt als Jude, er mag zuvor gewesen sein und geglaubt haben, was er wollte. Durch die vollzogene Konversion gehört er voll zum jüdischen Volk. Aber wenn ein Jude sich taufen lässt, kann er nicht mehr als Jude gelten.
Und dieses Urteil konnte der tapfere Mann, der dort oben im Karmelkloster lebte, nur unter Protest akzeptieren. Er musste sich’s gefallen lassen, wie ein zugezogener Fremder und nicht als ein jüdischer Heimkehrer die israelische Staatsangehörigkeit zu erhalten. Nicht als sein gutes Recht, sondern aufgrund seiner Verdienste. Rufeisen hatte nie versucht, andere Juden zum Christentum zu bekehren oder zur Taufe überreden zu wollen. Juden brauchen doch nicht missioniert zu werden, sagte er. Sie gehören zum Volk Gottes. So war also die Taufe für Rufeisen keineswegs (wie in unserer Kirche) „heils-notwendig“. Aber dieser Mönch bestand trotzig darauf, ein getaufter Jude zu sein und zu bleiben. Auch als katholischer Priester. Und er sammelte Menschen, die eine vergleichbare Lebensgeschichte hinter sich hatten und die sich wie er gegen die strenge Trennung von Juden und Christen zur Wehr setzten. So entstand dort in Haifa und an anderen Orten eine kleine, hebräisch sprechende Gemeinde. Juden, die überzeugt waren und sind, dass die Bindung an Jesus sie nicht von ihrem Volk trennt. Dieser „hebräischen Christengemeinde“ hat sich Pater Daniel bis zu seinem Tod vor allem gewidmet. Und er ist nicht müde geworden, zu betonen, dass die Nachfolger Jesu doch allesamt Juden waren und dass also auch die erste Christengemeinde ganz zum (damals sehr vielgestaltigen) Judentum gehörte. Auch in einem langen Gespräch mit dem polnischen Papst hat er diese Meinung entschieden vertreten.
Erst im 4. „nachchristlichen“ (nach-christlichen?) Jahrhundert habe sich, so erinnerte uns Pater Daniel, die damals schon mächtige und nun griechisch sprechende Großkirche radikal von der hebräischen Urchristenheit getrennt, um sich fortan katholisch zu nennen und mehr an Rom als an Jerusalem zu halten. Aber „katholisch“ (d.h.: „umfassend“) dürfe sich doch eigentlich nur eine Gemeinschaft von Nichtjuden und Juden nennen, die sich auf den Juden Jesus beruft und an den in der Bibel bezeugten Gott glaubt. Alle großen Kirchen, die sich inzwischen „katholisch“ oder „evangelisch“ oder „orthodox“ nennen, hätten zu ihrem Schaden auf ihrem Weg durch die Geschichte etwas Wesentliches verloren: nämlich die Verbindung und die Gemeinschaft mit den Juden, also die Verbindung zu der jüdischen Wurzel des Christentums. Dafür hätten die Kirchen leider ein Christentum eingetauscht, das nicht mehr (gut jüdisch) fragt: was sollen wir tun? Was ist Gottes Wille für uns und für seine Welt? Sondern (eher griechisch): was muss man wissen über Gott? Was ist die rechte Lehre, die Doktrin? Pater Daniel wurde nicht müde, auf diese, wie er meinte, bedauerliche Ablösung des Christentums von seinem jüdischen Mutterboden hinzuweisen.
Lass uns noch kurz überlegen, wie nahe sich unser David Friedländer und dieser Daniel Rufeisen sind – und wie sehr sie sich allerdings auch von einander unterscheiden:
Friedländer hat 1799 angefragt, ob er nicht als Jude und also ohne die Lehrsätze der Kirche übernehmen zu müssen in die Kirche aufgenommen werden könnte. Er suchte eine Einigung mit Propst Teller nur auf der Basis eines bei109 derseits reduzierten Glaubens: Die Juden sollten auf ihre sonderbare, durch die Gesetze geregelte Lebensweise verzichten. Und fortschrittliche Christen könnten ja ihre inzwischen überholten und unverständlich gewordenen Glaubensaussagen um der Gemeinschaft willen etwas auf die Seite stellen. Dann könnte man sich ja auf den Hauptnenner einer vielleicht etwas verdünnten Religiosität einigen, nämlich auf der etwas nebelhaften gemeinsamen Überzeugung jener Aufklärungszeit: dass es „einen Gott“ gebe, dass der Mensch eine moralische Aufgabe habe und dass mit dem Tod nicht einfach alles aus sei. Friedländer hatte angefragt, ob nicht im Niemandsland zwischen Judentum und Christentum, aber unter dem weiten Dach der staatlich und gesellschaftlich so privilegierten Kirche, also neben der katholischen und protestantischen noch eine dritte, etwas unverbindlichere Religion, eine jüdische Konfession denkbar sei. Ob Friedländer das wirklich wollte? Ich bezweifle es, wie ich Dir neulich schrieb. Aber er wollte in aller Öffentlichkeit wissen, ob das vielleicht der Preis wäre, durch den Juden die ihnen so lange verweigerte Anerkennung und Sicherheit erkaufen müssten.
Rufeisen wollte, so scheint es mir, viel mehr: Er wollte beides ganz. Er versuchte, bei sich und bei denen, die mit ihm unterwegs waren, zusammenzuhalten, was ursprünglich zusammengehört und was sich jedenfalls zu unserem, der Christen Schaden, vielleicht auch zum beiderseitigen Schaden, getrennt hat. Er wollte ganz und gar Jude und auch ganz und gar Christ sein und herausfinden, was aus dieser Verbindung entstehe. Vielleicht könnte etwas von der Art des frühen Christentums wachsen? Wohl möglich, dass Christentum und Judentum nach so langer Entzweiung nur noch von solchen Einzelgängern oder in so kleinen Gruppen wie der von Haifa wieder zusammenfinden können. Wer aber das Elend des Christentums und das des Judentums begreift, der sollte für solche Einzelgänger und Kleingruppen eigentlich dankbar sein. Sie weisen auf einen Weg hin, der zurzeit noch kaum gangbar ist. Vielleicht wird er gangbar sein, wenn beide Seiten vollends merken, in welchem Schlamassel sie stecken. Beide. Jede auf ihre Art.
Und ein Letztes: Zwischen Friedländers Brief und Rufeisens Lebens-Experiment steht die ganz große Katastrophe des europäischen Judentums, von der das Leben des jungen Oswald Rufeisen nicht nur einmal schier verschlungen wurde. Ungezählte wurden verschlungen. Nein! Nicht verschlungen, sondern ermordet wurden sie von solchen Deutschen, die meistenteils getauft waren. Siehst Du, David: Die Geschichte der Entfremdung zwischen Christen und Juden kann man gemütlich aus der Distanz des Zuschauers studieren. Sie kann einen, der Deutscher ist und Christ sein möchte, aber auch beunruhigen und aufschrecken. Und ich versuche in meinen Briefen, Dir und ein paar anderen Freunden meine Beunruhigung und meinen Schrecken über das, was da passiert ist, was versäumt wurde und was in seiner Tragweite und in seinen Konsequenzen noch wenig erkannt wird, mitzuteilen. Heute vor sechs Jahren ist Pater Daniel in Haifa beerdigt worden.
Danke, lieber David, dass Du mir immer noch zuhörst. Und einen herzlichen Gruß in Deine Schulferien hinein!
Dein Großvater
P.S.: Weil ich am Anfang dieses Briefes, beim Thema Haifa und Karmel, auch den Propheten Elia erwähnte – und weil viele brave Christen von jener alt- blutigen Geschichte in 1. Könige 18 nur den schlimmen Schluss kennen – weil sich auch manche meiner Kollegen über die Grausamkeit des „alttestamentlichen“ Gottesmannes empören und gelegentlich (mit einem Seitenblick auf israelische Politiker unserer Zeit) unverschämterweise unterstellen, dieses Abschlachten der Baalspriester sei typisch (oder gar vorbildlich?) für die Härte und Intoleranz der jüdischen Religion – darum will ich noch anmerken, dass (erstens) in der Bibel nicht steht, Gott habe dem Elia be- oder empfohlen, die 400 Götzenpriester zu „schlachten“. Also hat Elia wohl im Eifer ein Übriges getan? Dann wäre ihm dieser Blutrausch (siehe die Fortsetzung in 1. Könige 19!) auch übel bekommen. Zweitens war es im Altertum allerdings nicht unüblich, dass das Kultpersonal einer klar unterlegenen Gottheit mit dem Leben für solch eine Niederlage bezahlen musste.![]()
Stuttgart, am 25. November 2004 der Mann, von dem ich Dir heute erzähle, ist kein Jude. Aber er ist auch kein Christ mehr. Seine Kirche hat er schon vor vielen Jahren enttäuscht verlassen. Und inzwischen hat er sich oft gefragt, ob er nicht den Schritt auf die andere, die jüdische Seite vollends wagen sollte. Aber seine Freunde, darunter auch ich, haben ihm dringend abgeraten: »Wenn Du kannst, dann bleib doch bitte, wo Du bist. Nämlich zwischen den Ufern. Denn so, gerade indem Du dazwischen stehst, könntest Du für beide Seiten ein hilfreiches Signal sein.« Und in der Tat: es gibt inzwischen Juden und Christen, die diesem Mann und seiner Frau in Dankbarkeit verbunden bleiben. Eine Art Brücke bilden die beiden nämlich, vergleichbar dem Pater Daniel Rufeisen, von dem ich Dir in meinem zwölften Brief erzählte. Gotthold ist vor fast 80 Jahren in einem kleinen Ort am Rande der Schwäbischen Alb geboren. Dort wuchs er als Sohn eines tüchtigen Schreinermeisters auf. Als Hitler zur Macht kam und als sich diese „Machtergreifung“ bis ins kleinste Dorf hinein auszuwirken begann, hatte Gotthold gerade seine Schulzeit begonnen. Er berichtet, dass unter seinen Lehrern auch aktive Nationalsozialisten waren, die bei jeder Gelegenheit Hitlers „Drittes Reich“ anpriesen und gegen die „jüdischen Volksfeinde“ hetzten. So viele Deutsche haben sich ja damals durch die „Erfolge“ der Nazis, deren fragwürdige Hintergedanken man nicht durchschaute, blenden lassen: Die schlimme Arbeitslosigkeit der Zwanziger Jahre schmolz dahin und wich bald einer Vollbeschäftigung, die freilich nicht dem Frieden, sondern der Kriegsvorbereitung diente. Auch der Betrieb des Vaters von Gotthold S. blühte auf. Der Sohn war, wie die anderen Jungen, in der „Hitlerjugend“ organisiert. Juden gab es in seinem Heimatort keine. Aber die antisemitischen und gewaltverherrlichenden Lieder und Parolen jener Jahre hat er gehört und nachgesungen. Wie wir Jungen alle. „Hinter die Kulissen blickten leider nur wenige – viel zu wenige“, schreibt er. Nur seine Mutter habe dem neuen Staat nicht über den Weg getraut. Über den von allen hoch gepriesenen „Führer“ habe sie so verächtlich gesprochen, dass ihre Angehörigen oft Angst hatten, sie könnte deshalb angezeigt und eingesperrt werden (weißt Du, oft waren es die Mütter, die schneller als ihre Männer und Kinder den großen Betrug der Nazis durchschauten). Gotthold war begeisterter Segelflieger. Aber schon als Sechzehnjähriger musste er im elterlichen Betrieb den früh zur Wehrmacht einberufenen Vater vertreten, bis er dann selbst mitten im Krieg zur Luftwaffe eingezogen wurde. Alles in allem war das für damalige Zeiten eine durchaus „normale“ Kindheit und Jugend. Auch darin glich sein Erleben dem vieler anderer Soldaten, dass er dann die so sinnlosen wie verlustreichen Abwehrkämpfe der letzten Kriegsmonate mitmachte und schließlich in die russische Gefangenschaft geriet. Prügel gab es, als die Gefangenen durch die Straßen einer tschechischen Stadt getrieben wurden. Und schlimmer Hunger war auszuhalten. Schließlich wurde er mit vielen anderen zum Transport nach Russland in einen Viehwaggon gestopft. Und dann kam, auf diesem Elendstransport, der Tag, an dem sich Gottholds Leben und Denken gründlich und für immer ändern sollte. Ich zitiere aus einem Bericht, den er später aufgeschrieben hat: „Der Eisenbahnzug hielt wieder einmal an. Vielleicht war’s eine Gelegenheit, eine Hungerration zu empfangen? Doch plötzlich wurde die Tür aufgerissen, Geschrei ertönte: „Alles aussteigen!“ Wir standen auf dem Gelände des ehemaligen KZ Auschwitz! Sollte unsere Fahrt hier enden? Der heilsame Schock, den ich damals durchlitt und der mich bis heute verfolgt, beendete eine Scheinwelt, in der ich gelebt hatte. Dafür sorgten mit Nachdruck die Russen in den Tagen danach, als wir Gefangenen die schreckliche Geschichte dieses Ortes erfuhren. Mein eigener, elender körperlicher Zustand, meine Ohnmacht steigerte mein Erschrecken. Mir war zumute wie bei einem Gang durch die Hölle. Waren es Bestien in Menschengestalt gewesen, die hier gemordet hatten? Nein, es waren doch deutsche Menschen, die als Massenmörder in diesen Lagern jahrelang ihr Unwesen getrieben hatten. Grauen und Entsetzen verfolgten mich und ließen mich nicht wieder los. Bilder, die sich tief in die Seele einbrannten. In diesen Tagen schwor ich mir: Dreierlei wollte ich herausbekommen, falls mir das Leben (bei sehr geringer Aussicht!) noch eine Chance dafür geben sollte. Gotthold war dann noch Monate als ein gerade zwanzigjähriger Kriegsgefangener in den Kohlegruben des Donez-Gebietes „beschäftigt“. Sein Glück war, dass er dort als Schreiner eine privilegierte Arbeit tun durfte. Und die Rettung seines halbverhungerten Lebens, das damals wirklich nur noch an einem Faden hing, verdankte er einer russisch- jüdischen Lagerärztin, die den Jungen in die Krankenbaracke aufnahm, ihm schließlich einen Platz im ersten Rücktransport von kranken Kriegsgefangenen verschaffte. „Ihr verdanke ich mein Überleben!“ Wahrscheinlich war diese Lebensretterin der erste jüdische Mensch, den er leibhaftig zu Gesicht bekam. Tagsüber waren angesichts der angespannten Lage nur kurze Spaziergänge möglich. Dabei und an den drei Abenden haben mir meine Gastgeber ihre Geschichte erzählt. Und ich begriff, dass die beiden für den Rest ihres Lebens nur noch einen Wunsch und Vorsatz hatten: das wollten sie tun, wozu mein Vater an jenem 10. November 1938 den Mut nicht aufgebracht hatte. Sie wollten sich als deutsche Nichtjuden ganz und konsequent zu den gefährdeten Juden stellen. Und zwar nicht nur in jenen wirklich bedrohlichen Tagen des Krieges. Sondern mit der ganzen Kraft und Zeit, die Gott ihnen noch geben würde. Gotthold, der Möbelfabrikant hat sich in einem großen Jerusalemer Alten- und Behindertenheim eine Werkstatt eingerichtet, in der er nun schon seit zwanzig Jahren täglich stundenlang (und auf eigene Kosten!) schreinert und repariert. Das sei sein „drittes Leben“, sagt er. Und seine Erna macht Besuche bei alleinstehenden Frauen, die das Grauen der KZ überlebt haben und noch jetzt an vielfachen psychischen und physischen Folgen leiden müssen. Eine von ihren Schützlingen lernte ich am Sabbatvorabend kennen. Sie hatte von deutschen Ärzten und Sklaventreibern in verschiedenen Lagern Unbeschreibliches erlitten …
Lieber David,
1. Wer ist das denn eigentlich: „der Jude“? Warum wurde und wird er so verfolgt?
2. Was bestimmte die Täter? Wodurch wurden sie zu Mördern?
3. Was kann ich gegen dieses mörderische Gift, welches unser Volk krank gemacht hat, tun?“
Und dann begann das zweite Leben des Gotthold S., dem später noch ein drittes folgen sollte. Du kannst Dir ja vorstellen, David, dass damals manche aus dem Krieg zurückkamen, die sich wie er in Zeiten allergrößter Not dies und das geschworen und für die Zukunft fest vorgenommen hatten. In den Anstrengungen der Nachkriegszeit gerieten solche guten Vorsätze allzu oft in Vergessenheit. Bei diesem Heimkehrer aber war es so, dass er die drei aus Auschwitz mitgebrachten Fragen nicht vergessen konnte. Im Gegenteil: sie verfolgten und beschäftigten ihn so sehr, dass er damit seiner Umgebung mehr und mehr auf die Nerven ging. Zunächst war er wieder aktives Glied seiner evangelischen Kirchengemeinde geworden, eifrig tat er ehrenamtlichen Dienst als Helfer im Kindergottesdienst und dann als Kirchengemeinderat.
Auf jene drei Fragen jedoch konnte er in seiner Kirche keine oder höchstens eine recht unscharfe und darum unbefriedigende Antwort bekommen, obwohl er sie wieder und wieder stellte. Im Gegenteil: er merkte allmählich, dass die christliche Kirche ein Teil der bitteren Antwort war: Hat denn nicht die Christenheit die Juden verfolgt – schon lange bevor es die Nazis gab? Waren die Motive des Antijudaismus nicht ursprünglich und immer wieder „religiöser“ Art? Und wenn er schließlich fragte, worin er sich, seinen Glauben ändern müsste, was er tun könnte, dass die in Deutschland offenbar seit alters eingewurzelte Judenfeindschaft überwunden würde, dann bekam er in seiner Kirche und von ihren Pfarrern meistens nur recht allgemeine, ihn überhaupt nicht befriedigende Auskünfte.
Auch das Studium der Bibel konnte seine zweifelnden Fragen nicht beantworten. Im Gegenteil: er fand im Neuen Testament vieles, was den im christlichen Abendland seit je verbreiteten Widerwillen gegen die Juden nur zu schüren schien: Die Juden seien die Feinde, ja die Mörder Jesu Christi. Vom heil-losen jüdischen Volk las er, das sich starrsinnig der Taufe und dem Glauben an Jesus Christus verweigere. Für diese jüdische Weigerung sei schon die Zerstörung Jerusalems durch die Römer eine verdiente Bestrafung gewesen. Und an die Stelle des alten, jüdischen Gottesvolkes sei ja dann bekanntlich bald die christliche Kirche getreten. Was im Alten Testament noch Hoffnung gewesen war, das sei im Neuen Testament in Erfüllung gegangen … All diese altbewährten Antworten jedoch konnten Gotthold S. nun nicht mehr beruhigen.
Ich kann es mir gut vorstellen, dass Gotthold mit seinem unruhigen Fragen den Freunden aus der Gemeinde und aus dem CVJM mehr und mehr auf die Nerven ging: »Du immer mit deinen Juden!« sagten die Freunde: »Hast Du denn kein anderes Thema?« Es sei doch genug, dass die deutschen Kirchen sich bald nach dem Krieg zu ihrer Mitschuld am Unrecht des Dritten Reiches bekannt, sich dafür entschuldigt hätten. Aber endlich müsse man die Vergangenheit auch einmal vergangen sein lassen. Und gegen die Juden habe ja keiner mehr etwas einzuwenden oder vorzubringen, zumal es in Deutschland ja keine Juden mehr gebe …
Als Gotthold aber nicht nachgab, sondern eigensinnig nach den Wurzeln des Antisemitismus weiterfragte, musste er hören: »Ach, geh Du doch zu deinen Juden und lass uns damit in Ruhe!« Diesen letzten Rat hat er dann auch befolgt, indem er zwischen 1960 und 1980 fast in jedem Jahr einmal oder mehrfach und mit Hilfsgütern beladen nach Israel gereist ist. Das war schon deshalb schwierig, weil seine Firma, inzwischen eine weithin bekannte Küchenmöbelfabrik, in jenen Wirtschaftswunderjahren florierte und seine Anwesenheit zu Hause eigentlich nötig war. Aber: „Wenn andere Urlaub machten, dann flog ich nach Israel. Zu „meinen Juden“, die Hilfe brauchten. Mir war klar geworden, dass ich als Christ und als Deutscher lebenslang Schuldner Israels bin und bleiben werde.“ Das wollte er sich nicht nur theoretisch klar machen, sondern durch die Tat beweisen. Aus der Kirche ist er eines Tages ausgetreten. Nicht leichten Herzens, aber in tiefer Enttäuschung. Er fand jedoch im Schwabenland einige Menschen, die ähnlich dachten. Außer seiner Frau gab es Freunde, die wie er sichtbare Signale geben und selbst Zeichen sein wollten: für eine wirklich veränderte christliche Einstellung zu den Juden und zu ihrem neuen, gefährdeten Staat. Inzwischen leben Erna und Gotthold S. schon seit 20 Jahren ganz in Jerusalem. Zu Hause hat man das kaum verstanden. Aber damit hatte Gottholds drittes Leben begonnen, in welchem er und seine Frau eigentlich nur noch eines vorhatten: Sie wollten in Israel solchen Juden tröstlich beistehen, die unter uns Deutschen gelitten hatten.
Und jetzt muss ich Dir erzählen, wie ich die beiden kennen lernte. Das sollte nämlich für mich ein unvergessliches Kriegserlebnis werden. Die meisten Menschen hier erinnern sich ja schon gar nicht mehr an jenen kurzen Zweiten Golfkrieg (1991), in dem es darum ging, mit einer multinationalen Truppe den Irak aus dem von ihm widerrechtlich annektierten Kuwait zu vertreiben. Ein letztes Ultimatum der UN hatte der irakische Präsident nicht ernst genommen. Er drohte aber mehrfach, dass er, falls er angegriffen werde, den verhassten Judenstaat mit Scud-Raketen beschießen wolle. Und weil er ja schon früher die irakischen Kurden mit Giftgas-Raketen bombardiert und zu Tausenden getötet hatte, rechnete man in Israel mit der Möglichkeit eines ebensolchen tödlichen Angriffs auf den in den arabischen Staaten so verhassten Judenstaat. Obwohl sich Israel bisher aus jenem Konflikt herausgehalten hatte, galt es allen Arabern als Schützling der USA. So war die Drohung Saddam Husseins also durchaus ernst zu nehmen …
Als im Januar 1991 die sich in Israel aufhaltenden Ausländer, nicht nur die Touristen, sondern auch z.B die deutschen Freiwilligen von „Aktion Sühnezeichen“ dringend aufgefordert wurden, das gefährdete Land möglichst schnell zu verlassen, entschied ich mich, wenigstens für eine Woche dorthin zu fliegen. Ich konnte mir nämlich denken, wie die Israeli sich nun, von allen Freunden im Stich gelassen, fühlen mochten. Anders als bei früheren Israel-Flügen, saßen diesmal außer mir keine Touristen im Flugzeug, sondern fast nur jüngere Israelis, die „für alle Fälle“ aus Europa in ihre bedrohte Heimat zurückkehrten. Was ich als Ausländer jetzt dort wollte, wo doch alle anderen Nichtjuden aus dem Land flohen, das verstand man nicht. Nach der Landung wurde ich darum so genau und so lange polizeilich befragt wie noch nie, bis schließlich ein herbei telefonierter Freund für mich bürgen und mich „befreien“ konnte.
Dann begann eine ganz besondere Reise: Ganz ohne Sightseeing und ohne Archäologie. Die Menschen auf Israels Straßen schienen mir nicht so lebhaft und quirlig zu sein, wie ich’s von früher gewohnt war. Vielmehr von einer eigentümlichen, trotzig zur Schau getragenen Ruhe bestimmt. Der Tourismus war zusammengebrochen; die Hotels blieben leer. Man rechnete mit dem Schlimmsten, und die Israeli sagten, sie fühlten sich wieder einmal allein und von allen „Freunden“ verlassen. Gasmasken wurden verteilt und die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Fenster mit Klebeband abzudichten und das gleiche für die Türen vorzubereiten. In den Nachrichtenprogrammen des Fernsehens sah man, wie Palästinenser – ungeachtet der eigenen Gefährdung – Freudentänze aufführten, weil nun durch irakische Raketen endlich wieder Juden „vergast“ werden sollten. Wie solche Ankündigungen auf die Israeli wirkten, für die jenes schreckliche Wort bekanntlich eine grauenhafte Bedeutung hat, kannst Du Dir vorstellen. Panik war nicht zu spüren; aber eine Mischung von tiefer Bitterkeit und Trotz. Wann hatten sich die Juden denn in den über vier Jahrzehnten seit der Staatsgründung unbedroht und wirklich sicher fühlen können? War Theodor Herzls Traum von einem Staat, der den Verfolgten endlich eine sichere Heimat geben sollte, doch nur ein Traum geblieben?
Auf meiner Rundfahrt, die mich in den ersten Tagen zu Bekannten im Norden führte, rieten diese mir, in Jerusalem nicht in ein (leeres) Hotel zu gehen, sondern zu Familie S., die mich Unbekannten denn auch überaus herzlich aufnahm. Dort erlebte ich mit Erna und Gotthold die ersten nächtlichen Raketen- Alarme. Der Rundfunk forderte auf, man möge die Gasmasken aufsetzen. Da stellte sich heraus, dass ich keine hatte. Aber die gute Erna bat am nächsten Morgen die zufällig vor dem Haus stationierten Soldaten um Hilfe. Einer von ihnen meinte, er habe zu Hause eine „Privat-Gasmaske“, die er dem deutschen Besucher für seine Jerusalemer Tage und Nächte ausleihen könne. So war auch ich „für alle Fälle“ ausgerüstet.
Ich erfuhr damals auch, dass es in Israel noch mehr solche merkwürdigen Deutschen gibt, die ausgerechnet dies zum Inhalt ihres Lebens gemacht haben. Manche von ihnen hat die Liebe zum jüdischen Volk wohl ein wenig blind gemacht. Sie sind inzwischen von allem Jüdischen und von Israel so begeistert, dass sie z.B. gar nicht wahrnehmen, was in diesem Staat leider nicht so läuft, wie es dessen Gründer wünschten.
Weißt Du, bei manchen christlichen „Judenfreunden“ verbindet sich nämlich die Liebe zu Israel mit einem Unverständnis für die andere Seite des dortigen Konflikts, gelegentlich sogar mit einer gewissen Verachtung der Palästinenser. Es gibt fundamentalistisch denkende Christen, meist amerikanischer, radikal anti-islamischer Prägung, denen es am liebsten wäre, wenn die Juden die beiden islamischen Heiligtümer auf dem Jerusalemer Tempelberg in die Luft sprengen und dafür einen neuen jüdischen Tempel aufbauen würden. Aber das wünschen sie nur, weil sie auf Grund einer (missverstandenen) Stelle im Römerbrief meinen, dass dann am Ende Jesus wiederkomme und alle Juden sich zu unserem (!) Heiland bekehren werden. Und sicher hast Du auch von solchen Israelis gehört oder gelesen, die im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung meinen, der jüdische Staat dürfe keineswegs auch nur einen Quadratmeter des von ihm eroberten und besetzten Landes wieder freigeben. Auch sie begründen diese Forderung mit einem buchstäblichen, aber ganz ungeschichtlichen Verständnis bestimmter Bibelstellen. Aus dieser extremen Gruppe kam zum Beispiel der Mörder Jitzchak Rabins …
Gotthold gehört nicht zu jenen frommen Scharfmachern, die es im Christentum wie im Judentum und im Islam gibt und von welchen ich Dir vielleicht später noch etwas schreiben könnte. Wo er als Schreiner arbeitet, nämlich in einem großen Alten- und Behindertenheim, hat er guten Kontakt auch zu den dort beschäftigten Arabern. Und er kennt deren Not und Frust. Er weiß auch von der inneren Gefährdung der Israelis, nach bitteren Erfahrungen hart zu werden oder auch arrogant und verächtlich den Arabern gegenüber. „Man ist nicht ungestraft Besatzungsmacht“, hat schon bald nach dem Sieg von 1968 ein nachdenklicher jüdischer Lehrer selbstkritisch zu uns gesagt. Er hat sich darum in einer der israelischen Friedensgruppen engagiert. Und als ich den Gotthold S. einmal auf die oft schikanöse „Behandlung“ der Palästinenser durch junge israelische Soldaten hinwies, schrieb er mir: „Ja, ich weiß: meine lieben Israelis werden noch viel lernen müssen.“ So darf er reden und schreiben, weil das, was auch er an der israelischen Politik kritisiert, nicht aus einem besserwisserischen oder gar höhnischen, sondern aus einem traurigen Herzen kommt, getragen von einer tiefen Solidarität mit dem jüdischen Volk. Wie anders klingen die pauschalen Verurteilungen Israels, die man hierzulande hören kann! Da reden viele so, als gelte es nicht nur einen bestimmten politischen Kurs, sondern einen ganzen Staat anzuprangern. Und dafür habe ich seit jenem Januar 1991 immer weniger Verständnis.
Übrigens bin ich damals mit Gotthold am Freitag Abend im synagogalen Gottesdienst gewesen und habe gemerkt, welche Achtung er, der Nichtjude, dort genießt. Zwischen den jüdischen Betern hat er seinen festen Platz. Und inzwischen kann er dort auch schon ziemlich fließend die hebräischen Sabbatgebete nach- und mitsprechen. Nach dem Gottesdienst stellte er mich zu meiner Überraschung seinem älteren Nebensitzer vor: einem sehr berühmten israelischen Historiker. Der nahm mich auf die Seite und sagte: »Sie können sich kaum vorstellen, wie froh wir sind, dass es solche Deutsche und Nichtjuden gibt wie unseren Gotthold.«
Am nächsten Morgen, also am frühen Sabbatmorgen bin ich dann, dankbar für diese Begegnungen und für die neue Freundschaft mit zwei bewundernswerten Menschen, mit einem Taxi zum Flughafen gefahren und dort wieder in einen Luftalarm geraten. In einem nicht sehr großen Raum waren viele Menschen zusammengepfercht, als in der Nähe zwei irakische Raketen einschlugen. Alle Juden hatten Gasmasken auf. Nur ein Hund und ich, der Deutsche, hatten keine zur Verfügung. Obwohl ich natürlich Angst hatte, kam mir das irgendwie passend vor.
Man könne, schrieb ich Dir eingangs, diesen schwäbischen Schreinermeister und seine gute Frau mit Daniel Rufeisen, dem polnischen Karmelitermönch vergleichen. Der Unterschied: Pater Daniel wollte beides ganz sein: sowohl Jude (von Geburt) als auch Christ (in seinem Glauben an Jesus). Gotthold und Erna S. aber sind dazwischen hängen geblieben. Ohne feste Heimat. Sie denken auch nicht, sie seien schon am Ziel, sondern fühlen sich eher wie eine Hängebrücke, die zwei Kontinente verbindet, ohne zum einen oder zum anderen Ufer zu gehören. Auch ich bin sehr froh, dass es solche Brückenmenschen gibt.
Lieber David, es ist schon schade, dass wir zwei nicht bald einmal gemeinsam nach Israel reisen können. Vielleicht holst Du das später nach und besuchst dann all die Orte und Menschen, von denen ich Dir jetzt erzähle. Du könntest Dich ja zum Beispiel bei „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ erkundigen und um einen Platz als „Zivi“ bewerben. Ich weiß von einem ehemaligen Freiwilligen, der Dir darüber Auskunft geben könnte.
Herzlich grüßt Dich Dein alter Großvater
P.S.: Eben merke ich, dass ich Dir heute vor einem Jahr den ersten der“Briefe an David“ geschickt habe. Wir können also einen Geburtstag feiern! ![]()
FRIEDRICH GÖLZ
Briefe an David
Briefe an David
Die hier kostenlos als vollständige Fassung angebotenen "Briefe an David" können zur nicht-kommerzielle Nutzung als pdf-Datei heruntergeladen werden. Dies geschieht auf Grundlage einer Creative Commons Lizenz. Nähere Informationen erhalten Sie hier.
Der Autor
*******
wurde am 10. April 1927 in einem Stuttgarter Pfarrhaus geboren. Auf dem Schulweg erlebte er den Morgen nach der Pogromnacht (November 1938). Im Zweiten Weltkrieg war er Luftwaffenhelfer und am Ende noch Soldat. Seine vier älteren Brüder sind gefallen. Nach dem Theologiestudium war er Pfarrer der Württembergischen Landeskirche: einige Jahre als theologischer Lehrer am Missionsseminar in Wuppertal-Barmen, dann in Tailfingen auf der Schwäbischen Alb und in der Stuttgarter Haigstgemeinde. Ein Studienjahr konnte er in den USA verbringen. 1962 promovierte er mit dem Thema "Der primitive Mensch und seine Religion" (Gütersloh 1963) zum Doktor der Theologie. Einige Jahre war er in der Pfarrerausbildung tätig, dann bis zum Ruhestand (1990) als Studenten- und Gemeindepfarrer in Stuttgart-Hohenheim. Dortige Predigten sind in dem Band "Gehören die Christen zu Gottes Volk?" (Stuttgart 1996) veröffentlicht.
Frieder Gölz hat vier Kinder und zwölf Enkelkinder.
Kontakt zu COMPASS und/oder dem Autor:
redaktion@compass-infodienst.de
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo: