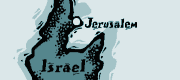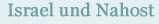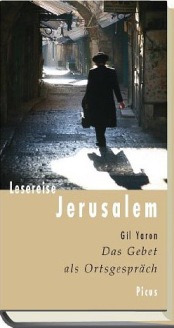Rezension: "Jerusalem - Das Gebet als Ortsgespräch"
Iron Dome statt Chuppa
[JÜDISCHE ALLGEMEINE WOCHENZEITUNG]Kriegsgegner im Abseits
Israel kann nicht siegen
Zu Gast bei ...
Nachfolgend lesen Sie einen Original-Beitrag des evangelischen Theologen Hans Maaß. Als Schuldekan und Kirchenrat war er über zwei Jahrzehnte im Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe für alle Fragen zuständig, die den Religionsunterricht an Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen betreffen. 1992 - 2003/2004 Lehrauftrag an der PH Karlsruhe für Neues Testament und Judentum. Maaß ist u.a. Vorstandsmitglied im Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
COMPASS dankt dem Autor für die Genehmigung zur Wiedergabe
seiner Rezension an dieser Stelle.
Jerusalem - Das Gebet als Ortsgespräch
Dr. Hans Maaß
Am Beispiel eines Arabers aus Lifta namens Odeh, der aus seinem Hass gegen Israel keinen Hehl macht, und eines Juden aus Jerusalem namens Yaniv stellt er die beiden Perspektiven der dramatischen Ereignisse seit dem UN-Teilungsbeschluss dar. Auch wer meint, die Geschichte zu kennen, erfährt viele neue Details – auch über Deir Jasin – sowie „ethnische Säuberungen“ und propagandistische Übertreibungen auf beiden Seiten. Von da an verlaufen die beiden Narrative in großen Zeitsprüngen. Interessant sind auch Yanivs Äußerungen zur Bedeutung der Klagemauer. Die Frage einer friedlichen Koexistenz von Juden und Arabern findet keine Antwort.
Kennen Sie einen Polizeichef, der vier Sprachen spricht, Geschichte studiert hat und Fachmann für Religionsfragen der großen Weltreligionen und ihrer Untergruppierungen ist? Gil Yaron stellt den Kommandanten der Davidswache samt dem Netz von Überwachungskameras in den engen Gassen der Jerusalemer Alt¬stadt vor. Einblick in die Seele eines israelischen Reiseführers, für den der Tempelberg nicht nur der Ort des Salomonischen Tempels, sondern die Stelle ist, an der man mit Gott ein „Ortsgespräch“ führen kann, bietet das Kapitel über den „Zauberberg“. Über die internen Auseinandersetzungen um Frauen in der Jerusalemer Öffentlichkeit, Ritualbäder und ihre unterschiedliche Bedeutung für verschiedene Gruppierungen führt Yaron seine Leserschaft entlang der Stadtgrenze im Norden aus der Sicht einer Friedensaktivistin, wobei seine eigene Position nur zu erahnen ist – bei dieser verzwickten Lage nicht verwunderlich. Sogar auf das „Jerusalem-Syndrom“ geht er ein, eine Psychose, deren markantes Beispiel Touristen bis vor einigen Jahren regelmäßig auf dem Weg zur Klagemauer in Gestalt eines Harfe spielenden König David wahrnehmen konnten. Der Psychiater Gregory Katz erklärt das Verschwinden dieser früher häufiger zu beobachtenden Krankheit mit dem Rückgang von „Idealismus und Religion“ in unserer Zeit. Der Psychiater Witztum präferiert andere Erklärungen. Gerade an diesem Kapitel wird deutlich, dass Yarons Buch offensichtlich aus ursprünglichen Einzelartikeln besteht.
Abu Dis und dem nie vollendeten Bau eines palästinensischen Parlamentsge-bäudes ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Gebäude entstand, als man noch der Meinung war, durch eine geschickte Trennungslinie Jerusalem so teilen zu können, dass es die Hauptstadt zweier Staaten sein könnte. Aber diese Pläne sind Makulatur, von der Entwicklung überrollt. Dennoch folgt ein Kapitel „Jerusalem, die Versöhnliche“. Man ist gespannt und wird in die Geschichte und gegenwärtige Arbeit der Augusta-Victoria-Kirche auf dem Ölberg eingeführt. Das vorletzte Kapitel nimmt „Jerusalem, die Alte“ in den Blick; es handelt sich aber nicht um einen Blick in die größtenteils unterirdischen Ausgrabungen der „Davidsstadt“, sondern um das Israel-Museum. Warum der Schrein des Buches auf diesem Gelände mit den kostbaren Qumran-Funden nicht erwähnt wird, hat sich dem Rezensenten nicht erschlossen. Im abschließenden Kapitel über Hightech und Historie streift Gil Yaron nicht nur ein einst für den Lubawitscher Rebbe Schneerson erbautes, aber nie von ihm bewohntes Haus, sondern geht aus¬führlich auf die Hightech-Firma des Professor Shashua ein, der als Standortvorteil Jerusalems vor allem die Nähe zu einer guten Universität schätzt.
Auch für Kenner Jerusalems ein lesenswertes Büchlein, erst recht für andere; bestens auch als Geschenk geeignet.
Gil Yaron:
Lesereise JERUSALEM.
Das Gebet als Ortsgespräch.
Picus Verlag, Wien 2014
130 S., geb., Euro 14,90
informieren und/oder bestellen
Abo-Hinweis
Dann abonnieren Sie unsere Seiten oder testen Sie uns vorab mit einem kostenfreien Schnupper-Abonnement!
Abo bestellen
Sie sind bereits Abonnent?
Dann melden Sie sich bitte erst mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, um die Fundstelle inkl. Quellenangabe und Link sehen und nutzen zu können!
Anmeldung